Gruppenpuzzle Energieversorgung
Wir haben im Unterricht das System Heizung in drei Teilsysteme zerlegt.
Wärmeerzeugung Wärmeverteilung Wärmeübertrager.
Im den folgenden zwei Stunden wollen wir uns einen Überblick über mögliche Alternativen zum klassischen Heizkessel als Wärmeerzeuger verschaffen.
Arbeitsphase 1:
![]()
-
Ihr wurdet zu Stammgruppen mit je drei Personen eingeteilt.
Bestimmt in der Stammgruppe einen Moderator. Dieser legt ein Protokoll an und notiert darauf die Stammgruppenmitglieder und das anschließend jeweils gewählte Thema für die spätere Wissensvermittlung. - Verteilt innerhalb der Stammgruppe die Themen A, B, und C, indem sich die Teilnehmer für eines der Themen entscheiden.
- Jedes Gruppenmitglied bearbeitet nur sein gewähltes Thema und arbeitet zunächst für sich alleine:
- Lest den Text konzentriert durch und markiert wichtige Textstellen, macht Euch ggf. Notizen.
Arbeitsphase 2:
![]()
Aneignung des Expertenstatus
Setzt Euch zu Themengleichen Gruppen zusammen. Maximal 3 Personen. Arbeitet den Inhalt des gewählten Textes so auf, dass Ihr ihn später in der Stammgruppe den „Nichtexperten“ weitergeben könnt.
- Bestimmt einen Moderator aus Eurer Gruppe, dieser übernimmt die allgemeine Koordination der Gruppenarbeit (Zeitplan, Arbeitsziel, Protokoll, Rückfragen).
- Legt für folgendes Vorgehen einen Zeitplan fest:
- Besprecht in Gruppe das gelesene und versucht eventuell aufgetauchte Fragen gemeinsam zu klären.
- Bereitet dann gemeinsam die Wissensvermittlung an die einzelnen Stammgruppen vor. Erstellt dazu ein Infoblatt (Kriterien siehe Anhang).
- Zieht Euch zum Schluss zurück und überprüft ob Ihr in der Lage seid, das Thema als alleiniger Experte Eurer Stammgruppe darzustellen.
- Der Moderator gibt nach Fertigstellung das Infoblatt als Kopiervorlage beim Lehrer ab.
Arbeitsphase 3:
![]()
Vermittlung von Expertenwissen
Die Experten informieren die „Nichtexperten“ reihum. Die „Nichtexperten“ haben Gelegenheit zum Nachfragen und zur Verständisklärung.
- Legt die Reihenfolge der Expertenvorträge fest. Der in Phase 1 bestimmte Moderator notiert die Festlegung und den Zeitplan und achtet auf die Zeiteinhaltung.
Arbeitsphase 4:
![]()
Sicherung
Fasse danach alle 3 Fachtexte zu einer gemeinsamen Mindmap zusammen. Auf den
Ästen des Mindmap stehen nur Stichworte und Skizzen,
keine Fließtexte
.
Im Zentrum des Mindmap soll der Begriff „Alternative Wärmeerzeuger“
stehen.
Gerne darfst Du auch auf andere Quellen zurückgreifen.
Kriterien für die Bewertung: Vollständigkeit, Übersichtlichkeit, Sauberkeit, Richtigkeit, Verständlichkeit der Skizzen.
Schreibe nach dem Erstellen der Mindmap 5 Fragen auf.
Folgende Regel: Alle Fragen müssen mit einem Verb beginnen. Also z. B. beschreibe, skizziere, begründe, etc.
Die Fragen werden vom Lehrer eingesammelt, denn die nächste Klassenarbeit kommt bestimmt.
Gruppe A:
Funktionsweise einer Photovoltaikanlage
Hier findet sich ein interessantes Video zum Thema:
www.youtube.com/view_play_list?p=4FAC1AB0C3362D19&search_query=solarmaus
Eine Solarzelle oder photovoltaische Zelle ist ein elektrisches Bauelement, das kurzwellige Strahlungsenergie, in der Regel Sonnenlicht, direkt in elektrische Energie umwandelt. Die Anwendung der Solarzelle ist die Photovoltaik. Die physikalische Grundlage der Umwandlung ist der photovoltaische Effekt, der ein Sonderfall des inneren photoelektrischen Effekts ist.
Durch Reihenschaltung von einzelnen Solarzellen und abschließende Kapselung entstehen die zur Energieerzeugung verwendeten Solarmodule. Die Reihenschaltung ist bei Dünnschichtmodulen in den Prozess der Zellfertigung integriert, bei den weit verbreiteten kristallinen Modulen durch Auflöten von Verbindern auf fertige Solarzellen realisiert.
Manchmal werden auch Elemente eines Sonnenkollektors als Solarzelle bezeichnet. Sie erzeugen aber keinen elektrischen Strom, sondern Prozesswärme und ersetzen beispielsweise Warmwasser-Boiler.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#Technische_Merkmale
| Vorteile der Photovoltaik | Nachteile der Photovoltaik |
| Kein Brennstoffverbrauch | Schwankungen im Energieangebot |
| Unendlich Basismaterial | Hohe Stromerzeugungskosten |
| Lange Lebensdauer | Geringe Leistungsdichte |
| Keine Abgase | Großer Flächenbedarf |
| Keine CO2-Emission | Kapitalintensiv |
| Viele Anwendungsmöglichkeiten |
Gruppe B:
Blockheizkraftwerk Strom und Wärme selbst erzeugen
Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine modular aufgebaute Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme, die vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben wird, aber auch Nutzwärme in ein Nahwärmenetz einspeisen kann. Sie nutzt dafür das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung oder Wärme-Kraft-Kopplung.
Als Antrieb für den Stromerzeuger können Verbrennungsmotoren, d. h. Diesel-, Pflanzenöl- oder Gasmotoren, aber auch Gasturbinen, Brennstoffzellen oder Stirlingmotoren verwendet werden.
Der höhere Gesamtnutzungsgrad gegenüber der herkömmlichen Kombination von lokaler Heizung und zentralem Kraftwerk resultiert daraus, dass die Abwärme der Stromerzeugung direkt am Ort der Entstehung genutzt wird. Der Wirkungsgrad der Stromerzeugung liegt dabei, abhängig von der Anlagengröße, zwischen 25 und 38 Prozent. Falls die Abwärme vollständig und ortsnah genutzt wird, kann ein Gesamtwirkungsgrad bezüglich eingesetzter Primärenergie von 80 bis 90 Prozent erreicht werden. Brennwertkessel erreichen Wirkungsgrade bis 100 Prozent, können aber keinen elektrischen Strom erzeugen.
Übliche BHKW-Module haben elektrische Leistungen zwischen einem Kilowatt (kW) und einigen zehn Megawatt (MW). Unter 50 kW spricht man auch von Mini-Kraft-Wärme-Kopplung (Mini-KWK), unter 15 kW von Mikro-KWK. Mini- und Mikro-KWK werden in Ein- und Mehrfamilienhäusern, in Betrieben und im Siedlungsbau verwendet. Die Kraft-Wärme-Kopplung wird ebenfalls in Heizkraftwerken genutzt, dort typischerweise mit elektrischen Leistungen von einigen hundert MW.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Blockheizkraftwerk
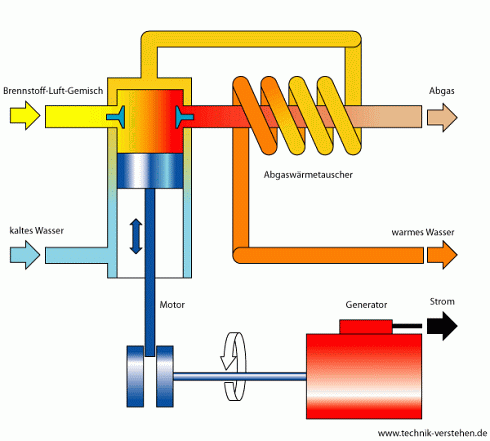
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Blockheizkraftwerk#/media/File:Bhkw_schema.png
Peter Lehmacher, CC BY-SA 3.0
Gruppe C:
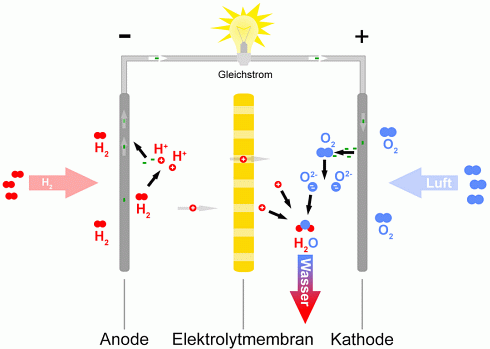
Christoph Lingg, gemeinfrei
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brennstoffzelle_funktionsprinzip.png
#/media/File:Brennstoffzelle_funktionsprinzip.png
1870 schrieb Jules Verne über die Brennstoffzelle:
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser,
das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des
Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die
Energieversorgung der Erde sichern.“
Wegen der Erfindung des elektrischen Generators, damals Dynamomaschine genannt, durch Werner von Siemens geriet die als „Galvanische Gasbatterie“ bezeichnete Erfindung zunächst in Vergessenheit. Die Dynamomaschine war in Verbindung mit der Dampfmaschine bezüglich Brennstoff und Materialien relativ einfach und unkompliziert und wurde daher zu dieser Zeit der komplexen Brennstoffzelle vorgezogen.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle
Funktionsweise
Die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff ist als Knallgasreaktion aus dem Chemieunterricht bekannt. Wasserstoff und Sauerstoff richtig gemischt, ein Glimmstab hinein, und schon gibt es einen heftigen Knall. Bei dieser Reaktion wird viel Energie frei.
2 H2 + O2 -> 2 H2O
Der Trick an der Brennstoffzelle ist nun, dass Wasserstoff und Sauerstoff nie unmittelbar miteinander in Berührung kommen, es also keinen Knall gibt: Sie werden durch ein Material getrennt, das die Funktion eines Elektrolyten hat. Das Material kann eine dünne Folie sein, eine Säure oder Lauge, eine Schmelze von Karbonaten oder eine Keramik. Durch diesen Elektrolyten wird die Energie nicht explosionsartig und unkontrolliert frei, sondern in Form elektrischen Stroms.
Was passiert nun genau in der Brennstoffzelle?
Der Wasserstoff muss sich an der Anode in seine Bestandteile, zwei Protonen und zwei Elektronen, aufspalten. Dabei sind kleine Katalysatorpartikel behilflich, die dem Molekül einen kleinen Tritt zur Spaltung geben. Nun können die gespaltenen Moleküle als Protonen durch die Membran wandern. Die Elektronen werden nicht durch die Membran gelassen und fließen daher über ein äußeres Kabel. Auf diesem Weg verrichten sie elektrische Arbeit. Auf der anderen Seite der Membran, der Kathode, reagieren die Protonen und Elektronen mit dem Sauerstoff zu Wasser.
Bei der Reaktion wird nicht nur Elektrizität erzeugt. Die Gase, die die Zelle verlassen, nehmen die Wärme mit, die bei der Reaktion entsteht. Diese Wärme kann man auch nutzen, z. B. zum Heizen von Häusern.
Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
07_gruppenpuzzle_energieversorgung
[docx][122 KB]
07_gruppenpuzzle_energieversorgung
[pdf][347 KB]
Weiter zu
