Frühlings Erwachen - Interpretation
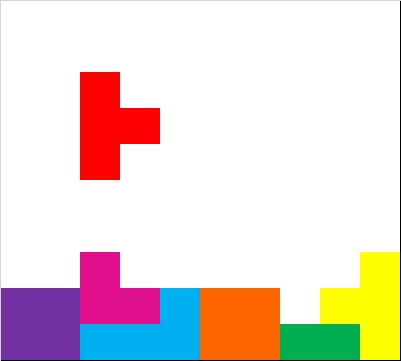 1. Einleitung
1. Einleitung Ein Schüleraufsatz ist eine komplexe Gesamtleistung und wird auch so bewertet. Deshalb ist es wichtig, die unterschiedlichen Bestandteile des Aufsatzes einzeln vorzubereiten und zu üben.
Um einen Konsens über Umfang und Inhalt einer Einleitung in einem literarischen Aufsatz zu erzielen, bieten folgende Materialien Anregung.
Ein Arbeitsblatt [doc] [50 KB]
fordert die Schülerinnen und Schüler zu einer kritischen Betrachtung unterschiedlicher Einleitungsbeispiele auf und führt zu einer Festlegung notwendiger und möglicher Inhalte. Ein Lösungsvorschlag [doc] [48 KB]
ist hier zu finden. Das nächste Arbeitsblatt [doc] [46 KB]
gibt den Schülerinnen und Schülern fünf verschiedene Formulierungen vor, die sie umschreiben müssen. Ziel ist es, automatisierte Formulierungen wie „In dem Roman geht es um …“ zu vermeiden.
In einer Übung
[doc] [46 KB]
sollen die Schülerinnen und Schüler zu einer vorgegebenen Textstelle mit Hilfe eines Beispiels eine eigene Einleitung und einen passenden Schluss verfassen.
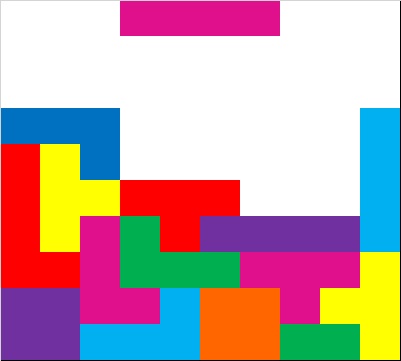 2.
Einordnung
2.
Einordnung Die Einordnung einer Textstelle wird oft verwechselt mit der Inhaltsangabe zum gesamten Werk. Die Schülerinnen und Schüler sollen deshalb erkennen, dass es gemäß der Aufgabenstellung darum geht, „den Textauszug im Kontext der vorangegangenen Handlung“ (MKS Baden-Württemberg, Musteraufgabe) zu bearbeiten. Es wird also nicht der Inhalt wiedergegeben, sondern nur das zusammengefasst, was für das Verständnis der Textstelle wichtig ist.
Zunächst werden die wichtigsten Handlungselemente des gesamten Dramas zusammengestellt, um den Schülerinnen und Schülern die Orientierung zu erleichtern. In der Form des kooperativen Lernens erhalten sie in einem Arbeitsblatt [doc] [212 KB]
unterschiedliche Textstellen, die sie in den Gesamtzusammenhang einordnen sollen. Die Lösung finden Sie hier .
[doc] [61 KB]
Mithilfe eines weiteren Arbeitsblattes [doc] [50 KB]
korrigieren die Schülerinnen und Schüler zwei Auszüge aus Schüleraufsätzen nach sprachlichen und inhaltlichen Aspekten.
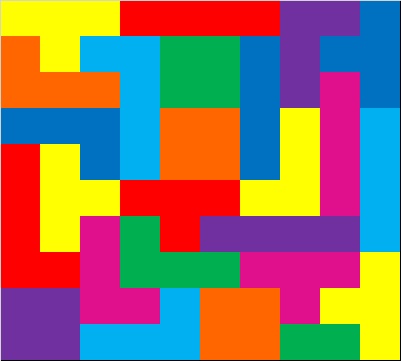 3.
Interpretation
3.
Interpretation Anhand eines Arbeitsblattes [doc] [61 KB] bereiten die Schülerinnen und Schüler die Interpretation einer ausgewählten Textstelle vor und formulieren eine entsprechende Deutungshypothese. Diese wird im Anschluss in Partnerarbeit besprochen. Danach erhalten sie den ersten Teil eines Schüleraufsatzes mit einigen Leerstellen, die auf Grundlage der Ergebnisse der Vorarbeit ausgefüllt werden sollen. Nach Besprechung der eigenen Ergebnisse sollen diese mit der Originalversion verglichen und beureteilt werden.
Das Arbeitsblatt [doc] [63 KB]
enthält einen weiteren, etwas schlechteren Schüleraufsatz zur bereits thematisierten Textstelle. Dieser soll nun mit Hilfe eines Korrekturblattes bewertet werden. Nach der Diskussion über die Ergebnisse der Aufsatzkorrektur sollen die Schülerinnen und Schüler den Beispielaufsatz komplett überarbeiten bzw. teilweise neu schreiben.
Abschließend ist es ihre Aufgabe, den überarbeiteten Aufsatz nochmals in gegenseitiger Kontrolle mit Hilfe des Korrekturblattes zu bewerten, um gegebenenfalls Schwachstellen in der eigenen Arbeit aufzudecken.
Zur Festigung und Vertiefung wird das bisher Gelernte nun an einer anderen Textstelle angewandt. Hierzu dient ein Arbeitsblatt [doc] [62 KB] . Ein häufiges Problem bei Schülerinnen und Schülern ist es, dass Textstellen nicht genau gelesen bzw. ganze Passagen bei der Interpretation übersprungen werden. Um dies zu vermeiden, bietet es sich an, ausgewählte Zitate der Textstelle zu erläutern, zu deuten und zu interpretieren. Danach soll, unter Einbezug der Erkenntnisse, ein vollständiger Interpretationsaufsatz zur gesamten Textstelle verfasst werden.
 4. Gestaltendes Interpretieren mit Schwerpunkt Suizid
4. Gestaltendes Interpretieren mit Schwerpunkt Suizid Die folgenden fünf Arbeitsblätter mit Aufgaben können variabel eingesetzt werden. Ein Vorschlag wäre, die Klasse in fünf Gruppen einzuteilen und jede Gruppe eine der Aufgaben bearbeiten zu lassen. Die Ergebnisse werden im Plenum präsentiert.
Die erste Aufgabe [doc] [42 KB] soll Moritz‘ Monolog vor seinem Selbstmord für die Schülerinnen und Schüler verständlich machen, indem sie einzelne Abschnitte in ihre heutige Sprache übertragen.
Die zweite Gruppe [doc] [42 KB]
formuliert einen Brief, den Moritz kurz vor seinem Selbstmord an Melchior schreibt und in dem er ihm sein Vorhaben erklärt. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen daraufhin Moritz‘ Motive mit den häufigsten Selbstmordgründen von Jugendlichen heute.
Die dritte Aufgabe [doc] [202 KB]
verlangt, dass die Schülerinnen und Schüler die Reaktionen der Personen bei Moritz‘ Beerdigung mit Hilfe einer Mind-Map darstellen. Sie informieren sich über religiöse und gesellschaftliche Hintergründe, die dieses Verhalten erklären. Aus Handreichungen zum Umgang mit Schülerselbstmord heute wählen sie Maßnahmen aus, die ihnen sinnvoll erscheinen, und begründen ihre Wahl.
Die vierte Gruppe [doc] [42 KB] ersetzt den Briefwechsel zwischen Moritz und Frau Gabor durch einen Dialog. Aus Handreichungen zum Umgang mit suizidgefährdeten Jugendlichen wählen die Schülerinnen und Schüler die ihrer Ansicht nach am besten geeigneten Ratschläge aus und begründen ihre Meinung.
In einer fünften Aufgabe [doc] [50 KB] vergleichen sie Wedekinds „Frühlings Erwachen“ mit drei weiteren Werken, die Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlicht wurden und in denen ein Schüler Selbstmord begeht. Zum besseren Verständnis informieren sie sich daraufhin über das damals typische Familien- und Schulleben.
