Quellen des Stereotyps
Stereotype sind nicht angeboren, sondern erlernt. Sie sind das Ergebnis des Zusammenwirkens von Lebenswelt, sozialer Umgebung und Kultur. Man ist aufgewachsen in seiner Familie, in der Schule und in der Gesellschaft. Man wird beeinflusst von seinen Eltern, Lehrern, Schulkollegen, Freunden und anderen in der Gesellschaft. Man erwirbt die Kultur, Sitten und Gebräuche, Wertvorstellung und Lebensweise und entwickelt seine eigene Einstellung zu anderen Rassen und Nationen. Solche Einstellungen sind nicht überprüft und erprobt. Aus diesem Grund sind sie oft Stereotype auf der Basis der Erfahrungen der anderen. Außerdem spielen die Massenmedien eine immer bedeutendere Rolle bei der Stereotypisierung. In der heutigen Gesellschaft sind Massenmedien überall da. Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, Internet und Bücher sind alle Informationsträger. Sie übergeben ein große Menge von Informationen über unsere vielfältige Welt. Jin Zhao hat in ihrem Aufsatz „Das Deutschlandbild in einem Deutsch-Chinesischen Jointventure“ die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in einem deutsch-chinesischen Joint Venture Ende 2003 dargestellt und analysiert. Nach ihr spielen Zeitungen zur Vermittlung von Informationen über Deutschland die wichtigste Rolle. „Immerhin haben sich 24,6% der Befragten ihre Fakten über Deutschland beinahe ausschließlich daraus angeeignet“ (Zhao 2005:53).
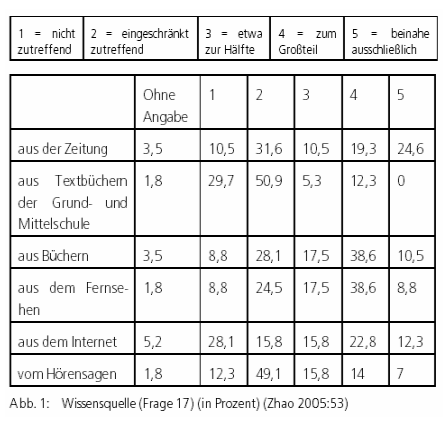
Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass Fernsehen, Zeitungen, Internet und Bücher wichtige Quellen der Stereotype sind. Aber jeder Staat hat verschiedene wichtige Quellen der Stereotypisierung. Zum Beispiel sind bei der Stereotypisierung in Bezug auf die USA neben den oben genannten Massenmedien die Filme aus Hollywood, die die amerikanische Lebensanschauung, Wertvorstellung wie zum Beispiel Individualismus und Streben nach dem Erfolg aus eigener Kraft weitergeben, auch eine wichtige Quelle für die Stereotypisierung.
Beispiele in Bezug auf Deutschlandsbilder in chinesischen Zeitschriften
In der Zeitschrift „ Du Zhe“(„Der Leser“) (2002 (19):7) steht ein Artikel namens „Starre Deutsche“. Darin wurde eine kleine Ge- schichte erzählt: “Eine Nacht regnete es sehr stark. Ein Vater und sein Sohn gingen eilig zum Arzt. Sie kamen in eine ruhige und abgelegene Straße und es schien an der kleinen Kreuzung Rot. Obwohl es keine anderen Menschen und keine Autos gab, warteten sie sehr lange an der Ampel. Nach einer langen Zeit verlor der Sohn die Geduld und wollte die Straße überqueren. Aber er wurde sofort von seinem Vater gehalten und kritisiert. Am Ende erkannten sie, dass die Ampel kaputt war. Nur das rote Licht schien, und das grüne Licht schien nicht.“ Welche Eindrücke von Deutschen haben Sie nach dem Lesen dieser Geschichte? Vielleicht werden wir einerseits den Eindruck haben, dass die Deutschen unflexibel sind. Andererseits finden wir aber, dass die Deutschen Regeln streng einhalten, was zu bewundern ist. Solche Eindrücke bleiben vielleicht lange Zeit in unserem Kopf. Und wir glauben vermeintlich, dass alle Deutschen solche Eigenschaften haben. Aber tatsächlich hat jeder Deutsche seine eigene Eigenschaft. Viele Deutschen sind flexibel und haben nicht solche Eigenschaften. Trotzdem beeinflussen die gebildeten Eindrücke unsere späteren Urteile. Außerdem spielen die individuellen Erfahrungen bei der Stereotypisierung auch eine Rolle. Nachdem wir mit einigen Menschen aus anderen Ländern Kontakt aufgenommen haben, suchen wir oft die gemeinsamen Eigenschaften von ihnen. Manchmal halten wir solche Eigenschaften in ihrem Land für üblich und bilden somit Stereotype. In der Zeitschrift „ Du Zhe“(„Der Leser“) (2005 (3):48-49) ist ein Artikel von Yu, Lu mit der Überschrift „Großartiger Deutscher Geist“. Der Autor hat den deutschen Geist am Beispiel einiger Sachen und Erlebnisse in Deutschland dargestellt. Darunter sind zum Beispiel Gleichberechtigung, Selbstdisziplin, Einhaltung der Regeln usw. Er hat zum Beispiel gehört, dass der damalige Kanzler am Wochenende nur sein eigenes Auto benutzen durfte, um zum Urlaub zu fahren. Und die meisten Deutschen kaufen Fahrkarten, obwohl es keine ständige Kontrolle gibt. Für die Einhaltung der Regel hat er eine Geschichte erzählt: Eine Gruppe von Studenten hat eine Untersuchung auf der Straße in einer deutschen Stadt gemacht. Sie klebten jeweils das Zeichen für „Männer“ und „Frauen“ an die Türen von zwei nebeneinander stehenden Telefonzellen. Das Ergebnis ist, dass alle Männer in die Telefonzelle mit dem Zeichen „Männer“ an der Tür gehen, und Frauen in die andere Telefonzelle. Nach ein paar Minuten standen vor der Telefonzelle mit dem Zeichen „Männer“ eine Schlange, obwohl die Telefonzelle „für Frauen“ leer war. Plötzlich kam ein Mann in Eile. Als er sah, dass die Telefonzelle „für Männer“ voll war, ging er ohne Verzögerung in die Telefonzelle „für Frauen“. Die Studenten fragten nachher und erfuhren, dass alle in Schlange stehenden Männer Deutsche waren, und der Mann, der in die Telefonzelle „für Frauen“ ging, ein Franzose war. Mit oben genannten Beispielen hat der Autor den Geist von Deutschland erläutert. Hier habe ich nur zwei Beispiele in Bezug auf Deutschlandbilder in chinesischen Zeitschriften gegeben. Daran können wir sehen, dass die Massenmedien doch bestimmte Informationen über andere Länder und Kulturen weitergeben. Und die Informationsempfänger, zum Beispiel die Leser der Zeitschriften, könnten sich nach dem Empfang solcher Informationen bestimmte Einstellungen zu anderen Kulturen bilden. Wenn die Einstellungen starr würden, könnten dann Stereotype entstehen.
Die Auswirkungen der Stereotype auf die interkulturelle Kommunikation
Stereotype haben negative Wirkungen auf die Interkulturelle Kommunikation. Wegen der Übergeneralisierung und Unvollständigkeit der Stereotype wird die Individualität nicht berücksichtigt. Man benimmt sich wie „ein Mann mit einer bunten Brille“. Bei der interkulturellen Kommunikation kann es Missverständnisse, Vorurteile und sogar Diskriminierung verursachen, was die Gefühle des Kommunikationspartners verletzen und die effektive Kommunikation hemmen kann. Shijie Guan meint, dass Stereotype und Vorurteile die interkulturelle Kommunikation folgendermaßen beeinträchtigen: (1) „das Geschehen der Interkulturellen Kommunikation verhindern“ (Guan 1995:186). Wenn man negative Stereotype gegenüber einem Kulturkollektiv hat, ist man nicht bereit, mit den Mitgliedern der Kulturkollektive umzugehen. (2) „die Qualität der Kommunikation beeinträchtigen“ (vgl. ebd.). Stereotype und Vorurteile haben Auswirkungen auf unsere psychologischen Tätigkeiten und unser Handeln, sodass wir bei der Wahrnehmung selektives Gedächtnis wählen und stützende Punkte für unsere Stereotype und Vorurteile suchen. Die Folge ist, dass wir uns mehr Zeit für die Bestätigung unserer Stereotype nehmen als für das wirkliche Verstehen des Kommunikationspartners, was zu verdrehender und abwehrender Handlung führen kann und die Stereotype und Vorurteile verstärkt, sodass ein Teufelkreis der negativen Kommunikation entstehen könnte. (3) „Diskriminierung hervorrufen“ (vgl. ebd.). Wenn man starre Stereotype und Vorurteile beherbergt, wird man beim Handeln und Sprechen aggressiver sein, was zur Diskriminierung führen kann.
Quelle: Jingtao Yu "Quellen des Stereotyps", interculture journal 2006/02
Dokument
herunterladen
[.doc][68
KB]
