Konstruktion des Satzspiegels
Bei der normalen Diagonalkonstruktion ist der Satzspiegel relativ frei bestimmbar, u.a. dadurch, dass ein beliebiger Punkt auf der Seitendiagonalen als Ausgangspunkt gewählt wird.
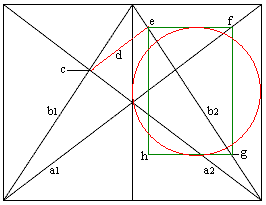
Bei der hier beschriebenen Methode ist der Satzspiegel jedoch nicht variabel bestimmbar, sondern ergibt sich aus der Wahl des Seitenformats. Bzgl. der Konstruktion geht man zunächst vor wie bei der normalen Diagonalkonstruktion, indem man Diagonalen über die Einzel- bzw. Doppelseite zieht (a1, a2, b1 und b2). Dann zeichnet man vom Schnittpunkt c der Diagonalen a2 und b1 ausgehend eine Linie d, die parallel zu a1 verläuft. Der Schnittpunkt dieser Linie d mit der Linie b2 der gegenüber liegenden Seite ergibt den Ausgangspunkt e für den Satzspiegel.
Der eigentliche Satzspiegel wird nun wie folgt konstruiert: Durch den Ausgangspunkt e zieht man eine Horizontale, die die Diagonale a1 in Punkt f, dem zweiten Eckpunkt des Satzspiegels, schneidet. Eine durch f gezogene Vertikale schneidet die Diagonale b2 in Punkt g, dem dritten Eckpunkt des Satzspiegels. Eine weitere Vertikale durch e bzw. Horizontale durch g schneiden sich in Punkt h und vervollständigen den Satzspiegel.
Wenn das Format der Einzelseite - wie bei diesem Beispiel - zudem noch im Verhältnis des Goldenen Schnittes steht (1:1,618), dann ist der Satzspiegel genau so hoch, wie die Seite breit ist (vgl. Kreis), womit eine ideale Proportion gegeben ist.
Nach dieser Methode hat Gutenberg den Satzspiegel seiner berühmten Bibel bestimmt.
