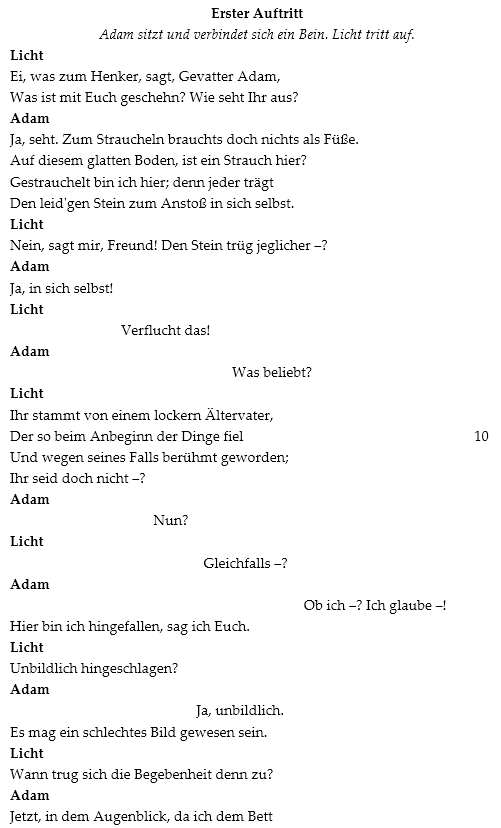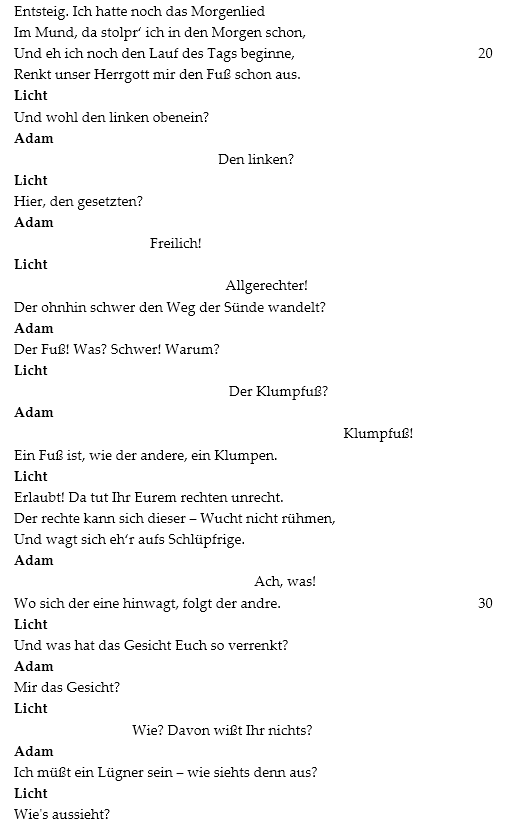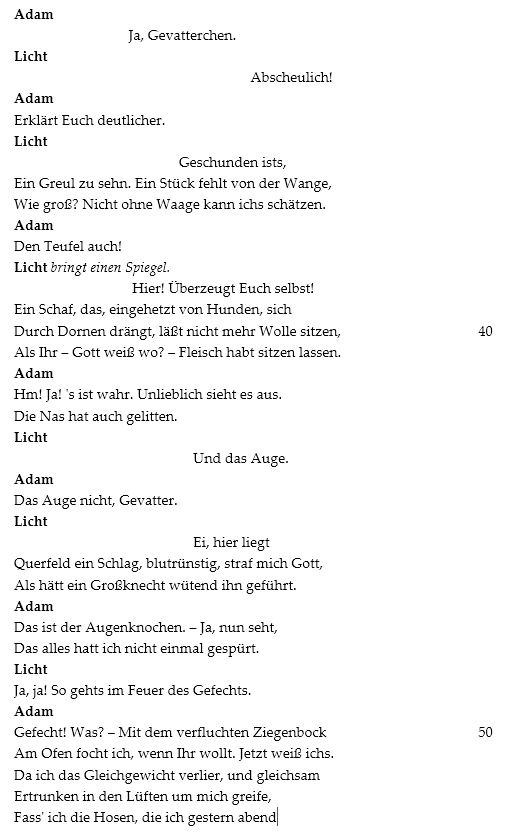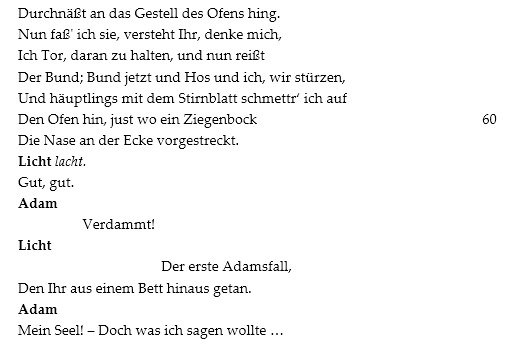Kleist, „Der zerbrochene Krug“
Heinrich von Kleist (1777 – 1811), Der zerbrochene Krug (1808)
Beim Betrachten eines Kupferstichs mit einer schwankhaften Gerichtsszene kommt dem Dichter Heinrich von Kleist die Oidipus-Tragödie in den Sinn. Aus dieser Idee entsteht dann eine der schönsten deutschen Komödien.
Vorrede
„Diesem Lustspiel liegt wahrscheinlich ein historisches Factum, worüber ich jedoch keine nähere Auskunft habe auffinden können, zum Grunde. Ich nahm die Veranlassung dazu aus einem Kupferstich*, den ich vor mehreren Jahren in der Schweiz sah. Man bemerkte darauf – zuerst einen Richter, der gravitätisch auf dem Richterstuhl saß: vor ihm stand eine alte Frau, die einen zerbrochenen Krug hielt, sie schien das Unrecht, das ihm widerfahren war, zu demonstrieren; Beklagter, ein junger Bauerkerl, den der Richter, als überwiesen, andonnerte, verteidigte sich noch, aber schwach: ein Mädchen, das wahrscheinlich in dieser Sache gezeugt hatte (denn wer weiß, bei welcher Gelegenheit das Delictum geschehen war) spielte sich, in der Mitte zwischen Mutter und Bräutigam, an der Schürze; wer ein falsches Zeugnis abgelegt hätte, könnte nicht zerknirschter dastehn: und der Gerichtsschreiber sah (er hatte vielleicht kurz vorher das Mädchen angesehen) jetzt den Richter mißtrauisch zur Seite an, wie Kreon, bei einer ähnlichen Gelegenheit, den Ödip [über der Zeile: als die Frage war, wer den Lajus erschlagen?]. Darunter stand: der zerbrochene Krug. – Das Original war, wenn ich nicht irre, von einem niederländischen Meister.“
*Le juge ou la cruche cassée, Kupferstich von Jean Jacques Le Veau (1729-1785) nach einem Gemälde von Philibert-Louis Debucourt.
Aufgaben
- Diskutieren Sie, welche Person des Kupferstichs welcher Tragödienfigur entspricht. Lässt sich immer eine eindeutige Entsprechung finden?
- Suchen Sie nach weiteren Parallelen zwischen der in der Vorrede angedeuteten Komödienhandlung und dem Oidipusstoff (z. Bsp.: Um welche Delikte handelt es sich jeweils?).
Die Zerstörung des Kruges entspricht insofern der Tötung des Laios, als es sich jeweils nicht um das schwerwiegendste Delikt handelt; das schlimmere Vergehen (begangen an Eve bzw. Iokaste) ist in beiden Fällen sexueller Natur. - Die von Schiller angedeutete Transformation der Oidipusfabel ins Komische wird gleich in der ersten Szene von Kleists Komödie deutlich. Untersuchen Sie, welche aus der Tragödie bekannten Motive er im Dialog zwischen Adam und Licht anklingen
lässt.
z. Bsp.: - Fehltritt (ἁμαρτία); bei Kleist: Straucheln (3 f.: … Zum Straucheln braucht’s doch nichts als Füße. / Auf diesem glatten Boden, ist ein Strauch hier?)Tragisches Schuldigwerden wird ins Komische (mit Wortwitz) transformiert.
- Die Erbsünde (9: Ihr stammt von einem lockern Ältervater …) entspricht der Verfluchung des Laios.
- Schwellfuß/Klumpfuß
- Motiv des Spiegels: Adam sieht nicht die Verletzungen in seinem Gesicht, bis Licht (!) ihm den Spiegel bringt. Insbesondere diskutieren die beiden darüber, ob auch das Auge gelitten hat (44 ff.).
- Der kluge Oidipus löst in seinem Scharfsinn das Rätsel der Sphinx, erkennt aber nicht sich selbst und seine Schuld (Motiv des Sehens, der Selbsterkenntnis, vgl. die Teiresiasszene).
Die Griechische Tragödie: Herunterladen [docx][65 KB]
Die Griechische Tragödie: Herunterladen [pdf][950 KB]
Weiter zu Leistungsmessung