7 Ein Modell für den Kontext
Versuchen wir nun, die Resultate unserer Umschau systematisch zu ordnen, um endlich wenigstens näherungsweise eine Antwort auf die Frage zu erhalten, was denn nun ein Kontext sei.
Die Definition des Kontextes muss heute sehr weit gefasst werden, um all
das einzubeziehen, was historisch in der Begriffsgeschichte dazugekommen
ist. Eine typische Definition besagt etwa, der Kontext sei die Menge "alle[r]
Elemente einer Kommunikationssituation, die das Verständnis einer Äußerung
bestimmen"
So weit diese Definition ist, so unkonkret ist sie; wir benötigen daher
unbedingt eine Einteilung in verschiedene Unterbegriffe bzw. Teile des Kontextes,
um genauer bezeichnen zu können, welchen Kontext wir jeweils meinen. Die
üblichen Einteilungen des Kontextes in "verbalen" und "nonverbalen", "situativen"
und "persönlichen" Kontext usw. variieren in der Fachliteratur jedoch erheblich
und sind teils widersprüchlich.
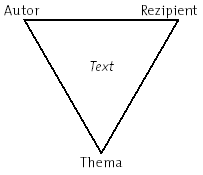 Um
sie aber zumindest zu ordnen, schlage ich vor, dass wir uns am klassischen Dreiecksmodell
der antiken Rhetorik orientieren. Dieses Modell bedeutet zwar eine starke Vereinfachung,
aber es ist immerhin etwas weniger primitiv und etwas zeitloser als das im 20.
Jahrhundert so beliebte Sender/Empfänger-Modell.
Um
sie aber zumindest zu ordnen, schlage ich vor, dass wir uns am klassischen Dreiecksmodell
der antiken Rhetorik orientieren. Dieses Modell bedeutet zwar eine starke Vereinfachung,
aber es ist immerhin etwas weniger primitiv und etwas zeitloser als das im 20.
Jahrhundert so beliebte Sender/Empfänger-Modell.
Bei Autor, Rezipient und Thema können wir all das ansiedeln, was man oft den "nonverbalen Kontext" nennt.
Der Autorkontext umfasst einerseits die ganze Lebenswelt des Autors, seinen geistigen Horizont, andererseits besonders die konkrete Situation, in welcher er einen Text verfasst, und seine Interessen, also die Autorintention. Im Falle eines Textes mit Erzähler oder Lyrischem Ich verdoppelt sich diese Dimension: wir müssen dann zwischem dem Kontext des realen Autors und jenem des fiktiven Erzählers oder des lyrischen Ichs unterscheiden.
Dass ich auch den Rezipientenkontext als genuinen Kontext ansehe, mag Sie überraschen,
da man klassischerweise den Kontext vom Leser her bestimmt und den Leser selbst
nicht in den Kontext einbezieht. Aber die strukturalistischen Theorien, welche
betonen, dass der Text gerade im Kontext des Leserbewusstseins operiert,
Der Themakontext schließlich umfasst die Sachzusammenhänge des Textes, insbesondere das Wechselspiel zwischen dem, was er explizit behandelt, und dem, was er implizit zum Verständnis voraussetzt. Bei fiktionalen Texten gehört auch das Wechselspiel zwischen erfundenen Ereignissen und der realen Situation zum Themakontext. Vielleicht finden Sie es naiv, dass ich so einfach vom "Thema" eines Textes spreche, schließlich ist das Thema v. a. lyrischer, in der Moderne auch erzählender Texte oft nicht ohne weiteres zu bestimmen: sie scheinen viele Themen zu haben oder gar kein Thema. Ich glaube aber, dass es für jedes Sprechen, das keine bloße Zungenrede sein will, irgendetwas geben muss, worüber man spricht, und seien es nur Wörter oder das Sprechen selbst. Nicht immer handelt es sich also um ein "Thema" im klassischen Sinne eines Aufsatzthemas oder eines Plots, aber es gibt doch immer ein Worüber des Sprechens, und zu diesem gehört der Themakontext.
Gewissermaßen auf den Linien zwischen diesen Kardinalpunkten können wir deren Wechselbeziehungen ansiedeln, also etwa die Beziehung zwischen Autor und Rezipient, wenn diese eine besondere Rolle spielt. Hierher gehören Fragen (und Antworten) der Art: Wie stellt sich der Autor seinen Leser vor? WelchesWissen setzt er bei diesem voraus? usw. Auch dies gehört zum Kontext.
Zwischen alledem spannt sich der Text selbst auf und mit ihm das, was man
heute "sprachlichen Kontext" oder "Ko-Text" nennt. Die übliche Differenzierung
zwischen Mikro- und Makrokontext ist aber bei weitem nicht hinreichend. Vielmehr
kann der Ko-Text auf allen Ebenen: vom unmittelbaren Satzzusammenhang
eines einzelnen Wortes
Sie werden vielleicht einwenden, dieses Modell sei unscharf; denn beispielsweise
kann man den Zusammenhang eines Textes mit den anderenWerken des Autors nach
meiner Beschreibung sowohl als Autorkontext als auch als sprachlichen Ko-Text
auffassen. Ich denke aber, dass dies kein Widerspruch ist: man muss diesen Kontext-Typ
eben in unserem Modell irgendwo zwischen der Ecke "Autor" und dem Wort "Text"
in der Mitte ansiedeln, da der Text ja kontinuierlich zwischen den Ecken aufgespannt
ist. Ich lege darum Wert auf die Metapher "aufgespannt", weil der Text eben
eine Einheit bildet und daher auch sein Kontext trotz aller Vielfalt doch zusammenhängt.
Die Aspekte des Kontextes sind fließend, wir können sie zwar unterschiedlich
stark betonen und den verschiedenen "Ecken" des Textes zuordnen, aber Text wie
Kontext bilden eigentlich eine Einheit.
Ein Vorteil dieses bescheidenen Modells ist übrigens, dass es gleichermaßen für die klassische Auffassung vom Kontext als Zusammenhang mit der realen Welt geeignet ist wie auch für die strukturalistische Sicht, nach der alles textualisiert ist und ausschließlich im Medium der Sprache abläuft. Der "Autor" und sein "Leser" wären dann eben nicht die realen Personen und ihre Gedanken, sondern allein ihr sprachlich verfasstes Bewusstsein.
43 So Hadumod Bußmann (Hg.): Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart ³2002, s. v. "Kontext" (der Ausdruck "Menge" stammt von mir).
44 Man vergleiche etwa Bußmann (Hg.) ebd. mit Patrick Brandt/Rolf-Albert Dietrich/Georg Schön: Sprachwissenschaft. Ein roter Faden für das Studium der deutschen Sprache, Köln/Weimar/Wien ²2006, 289.
45 "Dreiecksmodell" ist kein gängiger Begriff, ich schlage diesen Namen zur griffgen Bezeichnung vor. In populären Darstellungen (man suche nur einmal im World Wide Web nach "Dreieck Rhetorik"!) ist oft vom "Dreieck der Rhetorik" die Rede, welches dann vereinfachend Aristoteles zugeschrieben wird; ich halte diese Redeweise jedoch für etwas irreführend: nicht die Rhetorik ist oder hat ein Dreieck, sondern sie benutzt ein Dreieck als Modell. Das Modell hat in der Antike keinen besonderen Namen, obwohl bzw. gerade weil es als Denkform von den meisten Rhetorikern vorausgesetzt wird, so etwa deutlich im Aufbau der Argumentation von Aristoteles' Rhetorik. Diese Denkform dient in der antiken Theorie insbesondere dazu, die "Angemessenheit" einer Rede in Bezug auf Autor, Rezipient und Thema zu beurteilen; da die Angemessenheit hier als Frage des Kontextes aufgefasst wird, lädt dies zur verallgemeinernden Anwendung des Modells auf alle Aspekte des Kontextes ein.
46 Diese Verortung des Textes als "Fläche" des Dreiecks ist meine eigene Ergänzung des Modells und wird zumindest bei den gängigen antiken Autoren nicht benannt; sie ergibt sich aber m. E. folgerichtig aus der Unterscheidung der drei Kardinalpunkte und erweist sich für uns im Folgenden als recht nützlich.
47 So Lotman: Struktur.
48 Umberto Eco, Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten, München 1987, besonders Kap. 3.
49 Ja theoretisch sogar einer Silbe, eines Lautes, wie das zitierte Quintilian-Beispiel vom Zusammenhang kurzer Silben verdeutlicht!
50 Es gibt eine hübsche und vielleicht auch für Schüler anregende Beschreibung dieses stummen Dialogs in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose (1980), dt. München 1982, aber ich finde gerade die genaue Stelle nicht. Die Suche muss also dem geneigten Leser überlassen werden.
51 Freilich ist es möglich, bei der Interpretation einen logisch inkonsistenten Kontext zugrunde zu legen, ja dies wird sogar oft unwissentlich geschehen. Diese Inkonsistenz, d. h. das Vorhandensein von Widersprüchen, ist jedoch eine rein logische Unvollkommenheit, sie ändert nichts am Zusammenhang des Kontextes. Auch unser Denken verfährt oft inkonsistent, d. h. schreibt widersprüchlichen Sätzen Wahrheit zu, und ist doch eines . . .
