Kommunikationssituation
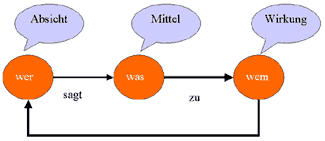
|
Ziele einer Präsentation
Am Anfang jeder Planung stehen die Ziele.
Sie definieren sich durch die Auswahl der Zielgruppe und die persönlichen Motive. Ich habe eine Motivation, mit einer gewissen Zielgruppe etwas Bestimmtes zu erreichen. Zwischen den einzelnen Elementen einer Präsentation lässt sich damit eine gewisse Logik des Ablaufs nachzeichnen: Denn: Nur wer weiß, was er will, kann den richtigen Weg einschlagen ! Je genauer Sie festgelegt haben, was Ihr Publikum am Ende der Präsentation wissen oder tun soll, um so sicherer können Sie die Inhalte auswählen, die Sie präsentieren müssen; und um so sicherer können Sie aus der Menge an Informationen, über die Sie am Anfang Ihrer Vorbereitung verfügen, die wichtigsten auswählen. Präsentation ist der Versuch, durch eine bewusste Gestaltung und Aufbereitung von Daten, Fakten und Aussagen den "Nutzungsgrad" von Information zu erhöhen und damit bestimmte Ziele zu verwirklichen. Auf dem Weg vom Sender zum Empfänger soll möglichst wenig verloren gehen. Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Leitziele unterscheiden.
Sie können Ihre Teilnehmer
- informieren und / oder überzeugen
- Kernaussagen, auf die nicht verzichtet werden kann
- Wichtige Aussagen, die das Thema abrunden
- Interessante Aussagen, die das Thema "würzen"
- Hintergrundmaterial, das der Absicherung dient
- Beispiele, Bonmots, Erfahrungen, die das Thema veranschaulichen
Fünf Grundregeln der Rhetorik
- Sachorientierung
Betonung der Inhalte
gute Vorbereitung
klare Gliederung und Struktur
- Verständlichkeit
Vereinfachung komplizierter Sachverhalte
Sprache (Fachbegriffe)
Deutlich und nicht zu schnell
Pausen (Mitdenken)
- Frei sprechen
Spickzettel / Karteikarten
Blickkontakt halten zum Publikum
- Körpersprache berücksichtigen
natürliche Mimik und Gestik
Glaubwürdigkeit / Authentizität
- Du-Orientierung
beachte die Voraussetzungen und Erwartungen des Publikums
weder Unter- noch Überfordern
Redezeit an Aufmerksamkeitsspanne des Publikums orientieren
Interesse wecken
zum Thema hinführen
Persönlichkeit
Sachziele allein genügen nicht für eine Präsentation. Präsentationen leben von der Darstellung (auch - und vor allem – des oder der Vortragenden). Eine wichtige Frage in der Planungsphase ist daher auch: Welchen Eindruck will ich machen?
Die Möglichkeiten auf diesem Sektor sind sehr groß; die Schwierigkeit besteht darin, einerseits über ein möglichst breites Repertoire zu verfügen und dieses mit der eigenen Persönlichkeit in Übereinstimmung bringen zu können.( Kleidung, Farben.....)
Jeder von uns versucht in Kommunikationssituationen eine "Erstidentifizierung" des Gesprächspartners vorzunehmen. Bevor jemand auch nur ein Wort gesprochen hat, wird er oder sie schon "eingeschätzt": Wie ist der oder die? Sympathisch? Natürlich? Überheblich? Zynisch? Aussehen? Kleidung? Alter? Position? Soweit man diese geheime Zeichensprache bewusst steuern kann (etwa Kleidung, äußerer Eindruck etc.), kann es sinnvoll sein, sie dem Zielpublikum und der eigenen Persönlichkeit entsprechend anzupassen.
Motive
Welche Motive bewegen mich? Was ist mein eigenes Interesse?
Der Kontakt
Präsentation ist Gespräch.
In welcher Weise, nach welchen Spielregeln dieses Gespräch stattfindet,
sollte in der Einleitung klar gestellt werden. Kann sich das Publikum
jederzeit in die Präsentation einbringen, gibt es Etappen, nach denen
Zwischenfragen vorgesehen sind oder gibt es nach der eigentlichen
Präsentation Gelegenheit zur Diskussion? Oft ist es sinnvoll, wenn
die TeilnehmerInnen erst am Ende zu Wort kommen.
Elemente dieser Kommunikation:
- Persönlichkeit - Auftreten und Verhalten
- Körpersprache - Mimik und Gestik
- Das Wort - gesprochen und geschrieben
- Die Darstellung - grafisch und visuell
Körpersprache
Sie ist weitgehend dem bewussten Zugriff entzogen und daher nur bedingt veränderbar. Mit seiner Körpersprache umgehen, heißt sich selbst erkennen, sich selbst beobachten. Will man sie ändern, ist sehr viel Training notwendig. Körperhaltung Blickkontakt Mimik (Gesichtsausdruck) Gestik Stimme mit den Merkmalen:
- Lautstärke
- Stimmlage
- Modulation
- Sprechtempo
- Pausen
- Abstand zwischen den Gesprächspartnern
- Winkel zwischen den Gesprächspartnern
Untersuchungen zeigten, dass 55 % der Wirkung einer Präsentation von Haltung, Gestik und Blickkontakt des Referenten abhängen, 38 % von der Stimme und nur 7 % vom Redeinhalt.
Regeln für die Kontaktnahme:
- Die Personen ansprechen
- Blickkontakt halten, sich nicht hinter Medien verschanzen, einzelne TeilnehmerInnen direkt ansehen.
- Offene Gestik (Arme und Hände dem Publikum zugewandt, Arme nicht verschränken)
- Bewegung (Wechsel der Körperhaltung, auf die Gruppe zugehen)
- Positive Beziehungen herstellen
- Sachlich und fair argumentieren Gemeinsamkeiten hervorheben
Aufmerksamkeit erregen und lenken
- "Stilmittel" der Stimme (Tonlage ändern, Tempowechsel, Lautstärke und Stimmlage modulieren)
- Medieneinsatz bzw. die Visualisierung von Inhalten (am wirksamsten durch Entwicklung direkt vor den Augen des Auditoriums)
- Bildhafte Sprache, der Einbau von Beispielen, von Demonstrationsobjekten, der bewusste Umgang mit (Sprech-)Pausen etc..
Adressatenanalyse
Wer soll mit der Präsentation erreicht werden ?
- Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
- Geschlecht
- Alter
- Schulbildung
- Beruf
- Vorwissen zum Thema
- Einstellung zum Thema
- Leistungsfähigkeit
- Leistungsbereitschaft
- Interessen
- Erwartungen an die Präsentation
- Homogenität der Gruppe
Adressatenanalyse
Wen will ich erreichen? Wer sind meine wichtigsten Ansprechpartner? Vor welchem Forum auch immer man präsentiert: In der Regel ist im konkreten Fall nicht jeder Zuhörer gleich "wichtig". Auch vor der Schulklasse gilt dies. Präsentiert man als LehrerIn etwa eine Projektidee, so lohnt es sich durchaus, sich darüber Gedanken zu machen, welche SchülerInnen man in diesem Fall besonders ansprechen will (zum Beispiel die, die ohnehin immer für alles zu gewinnen sind, oder die, die sich ansonsten eher im Hintergrund halten. Oder: Wendet man sich eher an die Mädchen in der Klasse oder an die Jungen?)
Zielgruppe
Der Empfänger steuert auch mein Handeln. Die Zielgruppe bestimmt weitgehend die (von mir) formulierten Ziele. Jede gute Präsentation orientiert sich am Publikum. Was ich mache und wie ich es mache, hängt stark davon ab, mit wem ich es zu tun habe. Wie kann ich Inhalte anschaulich machen für mein Publikum?
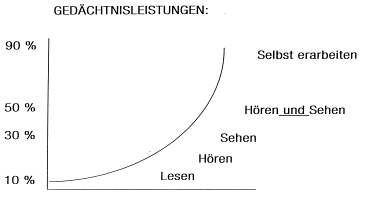
(C) Erfolgreich Präsentieren, Ein Leitfaden für den Seminarkurs, Landesinstitut für Erziehung und Unterricht, Stuttgart H-99/16, Juli 1999
