Erklärungsansätze - Rollenbilder
Bettina Hannover hat analysiert, in welcher Weise sich die Auseinandersetzung
mit den Rollenbildern auf die Interessenentwicklung bei Jugendlichen in der
Pubertät auswirkt. Dazu untersuchte sie vergleichend in koedukativen Klassen
und in reinen Mädchenklassen die Bedingungen, unter denen Mädchen
sich für als „unweiblich“ geltende Fächer entschieden
(Hannover 1992). Als zentralen Begriff verwendet sie dabei das spontane Selbstkonzept
einer Person. Damit wird beschrieben, welche Aspekte der eigenen Person in einer
gegebenen Situation abweichend, neu oder auf andere Weise besonders hervorgehoben
sind. Ihre Ergebnisse sprechen dafür, dass Mädchen, die im Unterricht
das spontane Selbstkonzepts der eigenen Geschlechtszugehörigkeit aktivieren,
eher weniger Interesse für typische „Jungenfächer“ entwickeln.
Da dieses Selbstkonzept durch die Anwesenheit männlicher Klassenkameraden
stärker aktiviert wird als in reinen Mädchenklassen, schlägt
sie beispielsweise in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
die Trennung in geschlechtshomogene Gruppen als eine Möglichkeit vor, diesen
auf die Mädchen sich negativ auswirkenden Einflussfaktor auszuschalten.
Nicht zuletzt als Reaktion auf diese Forschungsergebnisse ist in den letzten
Jahren vielfach mit der zeitweisen Aufhebung der Koedukation experimentiert
worden.
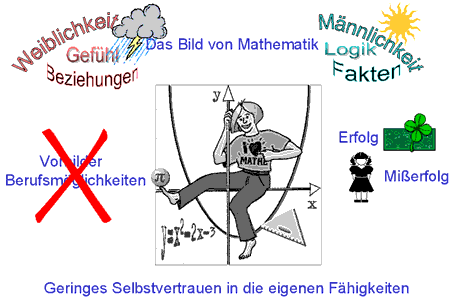
Speziell für das Fach Mathematik liegt eine empirische Untersuchung zur
Auswirkung eines zeitweise monoedukativ durchgeführten Unterrichts vor
(Nyssen, Ueter & Strunz 1996). Im Rahmen des BLK-Modellversuchs „Zur
Förderung von Selbstfindungs- und Berufsfindungsprozessen von Mädchen
in der Sekundarstufe I“ wurde an einer der beteiligten Gesamtschulen über
die Klassenstufen 7 bis 9 Mathematik monoedukativ unterrichtet. Die Auswertung
der Unterrichtsbeobachtungen sowie der Vergleich der monoedukativen und koedukativen
Unterrichtssituationen bestätigten die oben genannten Forschungsergebnisse.
Die Mädchen in der monoedukativ unterrichteten 9. Jahrgangsstufe entwickelten
großes inhaltliches Interesse am Fach und arbeiteten sehr konstruktiv
und mit Freude mit. Hinzu kommt, dass sie sich eine sehr ruhige und konzentrierte
Arbeitsatmosphäre schafften, die sich deutlich von der eher konkurrenz-betonten
Atmosphäre in der Jungengruppe unterschied. Noch wichtiger erscheinen mir
die Ergebnisse aus der Beobachtung der wieder zusammengeführten 10. Jahrgangsstufe.
Nach einer anfänglichen Zurückhaltung der Mädchen war im weiteren
Verlauf feststellbar, dass die Mädchen ihr Selbstbewusstsein in die eigenen
Kompetenzen behielten und sich mit ihrem Sozialverhalten im Unterricht nicht
nur gegenüber den Jungen durchsetzten, sondern sogar die gesamte Unterrichtssituation
positiv beeinflussten.
Ähnliche positive Effekte werden beim Einsatz des Computer – z. B.
im Rahmen des ITG-Unterrichts – mit zeitweise getrennten Gruppen berichtet.
Allerdings muss davor gewarnt werden, in der rein organisatorische Maßnahme
des getrennten Unterrichts die Lösung eines pädagogischen Problems
zu sehen.
Ich habe unterschiedliche Einflussfaktoren aufgezeigt, die sich auf die Mädchen
und ihre Einstellung zur Mathematik eher negativ auswirken. Eine genaue Wirkungsanalyse,
die auch Rückschlüsse auf die Leistungsunterschiede zulässt,
liegt mit der Promotion von Carmen Keller vor, die ich abschließend zu
diesem Teil in Kürze skizzieren möchte.
Carmen Keller befragte in der Deutschschweiz parallel zu TIMSS ca. 6600 Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 6 bis 8 über ihr Interesse an Mathematik,
das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, ihre Beteiligung
am Unterricht sowie die Geschlechter-Stereotypisierung von Schulfächern
(Keller 1997 & 1998). Dieser letzte Fragenkomplex wurde auch den Lehrkräften
vorgelegt. Die Ergebnisse der ersten Auswertung dieser Fragebogen bestätigen
im wesentlichen allgemein zu beobachtenden Tendenzen: Mädchen zeigen ein
signifikant geringeres Interesse an Mathematik als Jungen und ihr Selbstvertrauen
in Mathematik ist deutlich geringer als das der Jungen. Mädchen wie Jungen
betrachten – mit zunehmender Klassenstufe zunehmend – Mathematik
als männliche Domäne. Die Lehrpersonen ordnen Mathematik sogar in
noch stärkerem Ausmaß der männlichen Lebenswelt zu.
Carmen Keller hebt hervor, dass diese Stereotypisierung der Mathematik für
Mädchen und Jungen nicht das Gleiche bedeutet. Jungen ordnen Mathematik
dem eigenen, Mädchen dagegen dem anderen Geschlecht zu. Die Identifikation
mit Mathematik ist für Mädchen – vor allem mit einsetzender
Pubertät – damit viel schwieriger als für Jungen. Aus lernpsychologischer
Perspektive können daraus wiederum negative Auswirkungen auf die Lern-
und Leistungsvoraussetzungen resultieren. Diese These überprüft Keller,
indem sie die Wirkungszusammenhänge der einzeln erhobenen Merkmale einer
Mehrebenen-Analyse unterzieht.
In dem hier betrachteten Zusammenhang sind zwei Ergebnisse besonders hervorzuheben:
„Die Analysen haben gezeigt, dass das Selbstvertrauen in die eigene
Mathematikleistungsfähigkeit die Geschlechterdifferenzen in den Mathematikleistungen
vollständig erklärt. Die Mädchen erreichen schlechtere Leistungen,
weil sie in der Mathematik ein schlechteres Selbstvertrauen haben (...) Außerdem
hat die Stereotypisierung von Mathematik als männliche Domäne der
Mädchen und Knaben einen signifikanten Effekt auf ihre Leistungen: Mädchen,
die Mathematik weniger als männliche Domäne betrachten und Knaben,
die Mathematik mehr als männliche Domäne betrachten, haben bessere
Leistungen.
(...)
In der vorliegenden Arbeit wurde nicht nur untersucht, wie die Unterschiede
in der Mathematikleistung erklärt werden können, sondern auch, weshalb
die Mädchen ein schlechteres Selbstvertrauen, ein geringeres Interesse
und eine geringere Zuschreibung der Mathematik zum eigenen Geschlecht haben
als die Knaben. Die Stereotypisierung von Mathematik als männliche Domäne
erwies sich als wichtigster Grund für das schlechtere Selbstvertrauen
und das geringere Interesse der Mädchen. (...) Darüber hinaus ist
das Selbstvertrauen der Mädchen auch deshalb schlechter, weil sie weniger
Erwartungen von den Lehrpersonen wahrnehmen und weil die Lehrpersonen Mathematik
als männliche Domäne stereotypisieren und deshalb ebenfalls eher
den Knaben zuschreiben.
(...)
Dass die Mädchen Mathematik dem eigenen Geschlecht viel weniger zuschreiben
als die Knaben, ist unter anderem auch durch die Lehrpersonen bedingt: Mädchen
nehmen von der Lehrperson weniger Erwartungen wahr, und sie übernehmen
die Stereotypisierung der Lehrperson, Mathematik sei eine männliche Domäne.“
(Keller 1998, S. 146ff.)
Mit dieser Arbeit wird einerseits eine fundierte Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren
und ihrer Wechselwirkung vorgelegt. Andererseits zeigen die Ergebnisse aber
auch auf, wo eines der Kernprobleme liegt: im stereotypen Bild von Mathematik
als der männlichen Lebenswelt zugehöriger Bereich.
Aus den Untersuchungen zum Einsatz des Computers im Unterricht kann man an dieser
Stelle ergänzen, dass diese Tendenz durch den Computer noch zusätzlich
verstärkt werden kann, wenn dieser in erster Linie als technisches Gerät
und mit den entsprechenden Stereotypen behaftet wahrgenommen wird (vgl. hierzu
insbesondere Sinhart-Pallin 1990, Schründer-Lenzen 1995).
