Otfried Höffe
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
| 1943 | geboren in Oberschlesien |
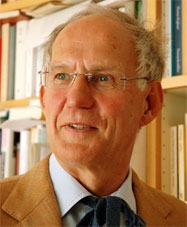
|
|
1992 –
2011 |
Lehrstuhl für Philosophie am Philosophischen Seminar der Universität Tübingen, Mitglied ihrer juristischen Fakultät und Gründer sowie Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie.
Mitglied in der Nationalen Akademie der Wissenschaften
|
Positionen zur Menschenwürde: Gegenwart
Die Menschenwürde als Superlativ zweiter Stufe - Wie hängen Menschenwürde und Menschenrechte zusammen?
„Methodisch ist die unantastbare Menschenwürde kein gewöhnlicher rechtlicher oder moralischer Grundsatz. Sie ist ein schlechthin höchstes Prinzip, ein Axiom oder ein Superlativ zweiter Stufe, sie bildet das Leitprinzip von Moral und Recht. Der Gehalt ist zweitens etwas, das es zu entfalten und zuzuschreiben gilt. Deshalb ist drittens der entscheidende Gehalt, die Unantastbarkeit nicht von Anfang an gegeben.
Das erste Argument bedarf noch einer Erläuterung: Superlative erster Stufe sind die Menschenrechte. Bei ihnen kann es vorkommen, dass ein Menschenrecht, zum Beispiel der Schutz der Privatsphäre, einem anderen Menschenrecht, etwa der Pressefreiheit, widerspricht. In derartigen Fällen ist eine Güterabwägung vorzunehmen, die das eine Menschenrecht im Namen des anderen Menschenrechtes einschränkt. Ein Superlativ zweiter Stufe lässt so etwas nicht zu. Die Menschenwürde ist ein normativer Anspruch, der gegen keinen anderen Anspruch abgewogen und eingeschränkt werden darf. Die unantastbare Menschenwürde richtet sich primär an den Gesetzgeber und den Richter. Ihnen verbietet sie, die Menschenwürde als den Superlativ zweiter Stufe im Namen anderer Interessen und Werte einzuschränken.“
[1]
Konzentration auf das Wesentliche: Was macht den Menschen als Mensch möglich?
„Statt den Menschen von dem her zu definieren, was ihm Glück, Selbstverwirklichung oder eine sinnerfüllte Existenz erlaubt, muss die Anthropologie normative und teleologische Begriffe verabschieden. Menschwerden im anspruchsvollen Sinn heißt, sich den Vollendungsbedingungen des Humanen zu unterwerfen. Der Gedanke der Menschenrechte begnügt sich dagegen mit dem, was den Menschen als Menschen möglich macht. In einer anthropologischen Bescheidenheit konzentriert er sich auf jene Anfangsbedingungen, die den Menschen als Menschen erst möglich machen, und nur deshalb verdienen sie die bekannte Qualifikation: Als dem Menschen unverzichtbare Elemente sind sie ihm angeboren und unveräußerlich; sie haben einen anthropologischen Rang.“ [2]
Diese Anfangsbedingungen, die das Menschsein ermöglichen, bezeichnet Höffe als transzendentale Interessen. Er meint damit Interessen, die Voraussetzung für alle anderen Interessen des Menschen sind. Nur wenn diese grundlegenden Interessen erfüllt sind, können die vielfältigen anderen Interessen des Menschen in den Blick genommen werden. Grundlegend ist das physische Leben. Wer nicht lebt, hat keine Chance auf weitere Interessen.
Allerdings schließt Höffe daraus nicht auf „Selbsterhaltung“ als höchstes Prinzip, sondern postuliert die Handlungsfähigkeit als transzendentales Interesse. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religionszugehörigkeit, strebe der Mensch zuallererst danach, ein handlungsfähiges Wesen zu sein. Damit erklärt Höffe auch, weshalb manche Menschen das Überleben nicht als höchstes Gut ansehen, zum Beispiel weil sie ihr Leben für einen Ideal opfern wollen.
[3]
Menschenrecht und Menschenpflicht: „Wieso darf ich von den anderen beanspruchen, dass sie die mir unverzichtbaren Interessen anerkennen?
Den Weg weist die Korrelation von Rechten und Pflichten; wobei der maßgebliche Gedanke generell, nicht etwa nur bei angeborenen Interessen gilt. Auf die Anerkennung einer Leistung besteht dort ein moralischer Anspruch, wo die Leistung nicht einfachhin, sondern lediglich unter einem Vorbehalt erbracht wird: unter der Voraussetzung, daß eine korrespondierende Gegenleistung erfolgt. Weil Menschenrechte einen Anspruch meinen, stellen sie kein Geschenk dar, das man sich entweder wechselseitig oder - aus Sympathie, aus Mitleid oder auf Bitten - einseitig offeriert. Vielmehr handelt es sich um eine Gabe, die nur unter Bedingung der Gegengabe erfolgt. Menschenrechte legitimieren sich aus einer Wechselseitigkeit heraus, pars pro toto: aus einem Tausch. Nun steht in der Menschen pflicht , wer die Leistungen, die lediglich unter Bedingung der Gegenleistung erfolgen, von den anderen tatsächlich in Anspruch nimmt. Umgekehrt besitzt er das Menschen recht , sofern er die Leistung, die nur unter Voraussetzung der Gegenleistung erfolgt, wirklich erbringt.“ […] [4]
Nicht deshalb gibt es Menschenrechte, weil der eine gibt, der andere nimmt, sondern weil ein wechselseitiges Nehmen und Geben stattfindet und weil darüber hinaus zwischen Gabe und Gegengabe ein ungefähres Gleichgewicht besteht. In moralischer Hinsicht basieren die Menschenrechte auf einer Moral, die sich in sehr verschiedenen Kulturen findet […]. Es ist die Moral der Goldenen Regel […], bzw. der Wechselseitigkeit (Reziprozität), die wohl in allen Kulturen eine Rolle spielt, allerdings mit jeweils unterschiedlich starkem Gewicht […].“ [5]
Arbeitsauftrag:
Erschließen Sie die zentralen Aussagen und den Argumentationsgang des Textes mit Hilfe der
Zeitschriftenmethode
(
Werkzeugkasten
).
[1]
„Menschenwürde a la Kant – Zur Aktualität eines traditionellen Konzepts“ / SÜDWESTRUNDFUNK, SWR2 AULA Fundstelle
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=2950780/property=download/nid=660374/b5fgle/swr2-wissen-20080127.rtf
[2] Otfried Höffe, Vernunft und Recht, Bausteine zu einem interkulturellen Rechtsdiskurs, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1270, 1996, S.66 f.
[3] Zusammenfassung nach Höffe, a.a.O., S.74 bis 77 .
[4] a.a.O., S.74.
[5] a.a.O., S.75.
zurück: Lösung Habermas
weiter: Lösung Höffe
Text und Aufgaben: Herunterladen [doc][741 KB]
Text und Aufgaben: Herunterladen [pdf][295 KB]
