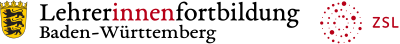Literaturwissenschaftl. Einordnung & Deutungsperspektiven
Die Bedeutung von Ludwig Tiecks Der blonde Eckbert liegt vor allem in seiner inhaltlich und poetologisch stilbildenden Wirkung für die Gattung des romantischen Kunstmärchens. Erstmals finden sich in Tiecks Novelle epochentypische Problemkonstellationen wie die Verankerung des Selbst im frühkindlichen Begehren, die Geburt der Identität aus dem Spannungsfeld von Ökonomie und Liebe oder die ambige Neugestaltung der Figur des Dritten als Beobachter und Manipulator der Paarbeziehung. In formaler Hinsicht entwickelt Tieck sein innovatives „Spiel auf der Schwelle“ (Koschorke 2012) über eine doppelte Narration, nämlich über die realistische Rahmenerzählung einerseits sowie über die märchenhafte Sozialisationsgeschichte Berthas andererseits. Hölter (2005) zufolge konzentrieren sich viele Untersuchungen, nicht zuletzt aus dem Bereich der Gender Studies, hauptsächlich auf die Binnenerzählung und somit auf das Schicksal Berthas. Dabei wird jedoch dem metaleptischen Aufbau der Novelle zu wenig Rechnung getragen, denn diese ist auf die Rekonstruktion einer doppelten Lebensgeschichte, derjenigen Berthas und Eckberts, ausgelegt. Transgressionen während der Schilderungen Berthas und der Rahmerzählung erfolgen in beide Richtungen, also von der realen Sphäre in die Märchenhafte und umgekehrt. Bertha besteht deshalb auch auf dem Wahrheits- und Realitätsgehalt ihrer Ausführungen, obwohl diese auf typische Märchentopoi wie die kindliche Flucht aus dem Haus der Pflegeeltern, eine mysteriöse Hexenfigur und magische Tiere rekurrieren. Dem steht die Verweigerung jeglichen Erzählens durch Eckbert gegenüber. Er vermag es nicht, sein Leben in einen narrativen Zusammenhang zu bringen. Deswegen hofft er aus den Schilderungen seiner Frau Hinweise über seine eigene Identität zu erhalten. Wie sich später herausstellt, hat er die frühen Kindheitsjahre, die er mit Bertha verbracht hat, vergessen oder verdrängt (Hölter 2005, Tatar 1987). Die geheime Verbindung der Geschichte Eckberts mit derjenigen Berthas wird erst am Ende der Novelle von der Alten gelüftet. Aufgrund der internen Fokalisierung von beiden Erzählebenen bleibt unklar (Greiner 1987), ob es sich bei Bertha und Eck bert nicht nur um ein inzestuöses Geschwisterpaar, sondern sogar um dieselbe Figur (*bert*) handelt. Berthas „Geschichte ihrer Jugend“ und die Rahmenerzählung, die Eckbert als Garanten für die Glaubhaftigkeit des Geschilderten in den Wahnsinn verfallen lässt, würden sich so nicht ergänzen, sondern gegenseitig überschreiben.
Blickt man auf die Sozialisationsgeschichte Berthas, so fällt vor allem der ökonomische Rechtfertigungsdruck auf, unter dem das Kind im Haus des Pflegevaters steht. Offenbar hat sich der arme Hirte von der Aufnahme des fremden Mädchens finanzielle Vorteile und die Möglichkeit zur Ausbeutung seiner Arbeitskraft erhofft. Bertha erweist sich jedoch als handwerklich ungeschickt und verweigert sich einer ökonomischer Indienstnahme. Dafür wird sie von ihrem Pflegevater schwer misshandelt. In ihrer Not hegt das Mädchen zunächst Suizidgedanken; letztlich nimmt sie davon Abstand und flieht stattdessen in das Reich der Phantasie. Bertha imaginiert eine Zukunft, in der sie den Wünschen ihrer Zieheltern nicht nur gerecht wird, sondern vielmehr deren Erwartungen durch Übererfüllung und Exzess konterkariert. Hier zeigt sich die Beschaffenheit des kindlichen Begehrens, das aus dem Trauma der väterlichen Gewalt entbunden wird in Form eines Gegensatzes von ökonomisch definierten Objektbegehren und einem aus der Phantasie geborenem Narzissmus. Auf dieser Grundlage lassen sich die Entwicklungen begreifen, die sich für Bertha nach der Flucht aus dem Elternhaus ergeben. Schnellen Schrittes entfernt sie sich von jeglicher Zivilisation, bis sie in eine karge Einöde gelangt. Versteht man die Topographie (Ebene, Gebirge, Wald, Felsen, Labyrinth) als Spiegelung der psychischer Disposition, so gelangt sie einen Nullpunkt ihres Selbst. Mit der alten Frau am Wasserfall, die von Tieck mit Attributen einer Hexe (schwarze Kleidung, schwarze Kappe, kreischender Ton) und einer Heiligen (Stärkung mit Brot und Wein, geistliche Lieder, Gebete) ausstaffiert wird, begegnen ihr dann eine Schicksalsgöttin (Helfer 2005) oder vielleicht auch Isis (Hubbs 1956), die in der Romantik so häufig beschworene Urmutter der Natur und der Liebe. Die alte mütterliche Frau führt Bertha in eine weiblich dominierte Idylle, wo sie das Trauma der väterlichen Gewalt lindern kann. Das aus der Phantasie erweckte Begehren bleibt in der paradiesischen „Waldeinsamkeit“, einer Wortneuschöpfung Tiecks, zunächst latent. Auf diese Weise kann Bertha an einem Bildungsprogramm teilnehmen, das von der Hauswirtschaft bis zur Literatur reicht. Handwerkliche Arbeiten, die ihr im Haus der Pflegeeltern so schwergefallen sind, erlernt sie wie später das Lesen mit Leichtigkeit, weil sie ihr nicht mehr unter dem Vorzeichen wirtschaftlichen Drucks beigebracht werden. Als Garant für ökonomische Unabhängigkeit figuriert der schöne Vogel, der täglich ohne Gegenleistung seine wertvollen Eier legt und dabei die „Waldeinsamkeit“, die Selbstgenügsamkeit und Selbstliebe (vgl. Greiner 1987), aber auch die umfassende Liebe zur Natur besingt. Zur „Familie“ der alte Frau gehört neben Bertha und dem Vogel auch ein Hund, dessen Name sich im Verlauf der Geschichte als „Kriminalwort“ (Bloch 1965) herausstellt. In ihm repräsentiert sich die bedingungslose, überschwängliche, auch körperliche Hinwendung zum anderen („Der Hund liebte mich sehr und tat alles, was ich wollte.“). Deswegen spielt er beim Eintritt Berthas in die Adoleszenz eine wichtige Rolle. Das in der frühen Kindheit vorgeprägte Begehren wird bei der Vierzehnjährigen erneut geweckt und durch die Lektüre von Heldenepen auf den Wunsch einer Liebe zum „schönsten Ritter von der Welt“ projiziert. Just in dem Moment, in dem sie ins Jugendalter eintritt und sich immer stärker dem Regelsystem der Erwachsenenwelt unterwerfen muss, flieht Bertha aus dem Naturidyll. Den lyrischen Vogel, dessen Lied ungehört von ihr verhallt, stiehlt sie vor allem als finanzielle Absicherung, während sie den Hund, den Repräsentanten der Liebe zu anderen, zurücklässt und damit dem Hungertod preisgibt. An seine Stelle soll der „schöne Ritter“ treten, der in ihrer Phantasie zu den – wörtlich zu nehmenden – „lustigenLeuten“ [Hvhg. d. V.] gehört. Bei der Rückkehr ins Heimatdorf kann sie „das, worauf [sie] am meisten immer im Leben gehofft hatte“, nämlich den aus der Verzweiflung erweckten Kindheitstraum, die Eltern mit „ihrem Reichtume“ zu überraschen, nicht mehr erfüllen. Die Hoffnung auf eine Heilung des Kindheitstraumas ist denn auch „auf ewig verloren“. An dieser Stelle zeigt sich der romantische Bruch mit der Gattung des „Volksmärchens“, in dessen narrativer Praxis die Rückkehr ins Heimatdorf wohl zu einem glücklichen Ende geführt hätte. Aus den erfolgreich durchgestandenen Prüfungen hätte sich ein Sinnganzes und eine moralische Richtlinie ergeben. Demgegenüber verkehrt sich die Situation in Tiecks Novelle zu Gewalt, Trostlosigkeit und Melancholie. Bertha lässt sich in einer nahen Stadt nieder und errichtet sich eine (spieß-)bürgerliche Existenz. Der Vogel, der sein eigenes Lied den neuen Umständen anzupassen vermag, erinnert sie mit seinem Gesang jedoch immer wieder an die Zeit ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur und ein im Schiller’schen Sinne „naives“ Selbst. Weil er sie aber damit auch an die Abkehr von der freundlichen Alten und den Tod des Hundes gemahnt, tötet sie ihn in der Absicht, sich dadurch von ihren Gewissenbissen zu befreien. Doch ihre Hoffnung erfüllt sich nicht, denn Bertha begegnet der Welt von nun an mit Misstrauen, weil sie befürchtet, selbst Opfer eines Diebstahls oder Betrugs zu werden. Ihr Argwohn überschattet den lange gehegten Wunsch nach einer Liebesbeziehung zu einem „überaus schönen Ritter“. Auffällig wortkarg schildet Bertha, wie sie sich dann mit Eckbert, einem wenig glanzvollen Vertreter des Ritterstandes, den sie – eine Prolepse auf den bald enthüllten Inzest! – zudem „schon sehr lange“ gekannt hat. Auch wenn sie gegenseitige Zuneigung betont, geht Bertha die Ehe wohl vor allem deswegen ein, weil sie ihre Schuld nicht allein tragen will. Die wenig später frei gewählte Isolation des Paares lässt sich somit als Ausdruck einer Weltflucht begreifen; sie stellt den Versuch dar, die traumatische Vergangenheit zu überdecken und sich für künftigen Zumutungen des Lebens zu schützen. Eine völlige Abschottung gelingt jedoch nicht, weil sich beide ihrer eigenen Identität ungewiss sind. Vor allem Eckbert drängt es, sowohl sein eigenes Selbst als auch das Mysterium seiner Liebe zu Bertha zu erkunden. Aus der Rekonstruktion von Berthas Lebensgeschichte erhofft er sich die Enträtselung des Ursprungs (weiblicher) Identität im Feld zwischen Liebe, Phantasie und Sexualität. Dieser Prozess erfordert jedoch eine dritte Person, die das bislang Unausgesprochene hört und beglaubigt. Nach Ernst Bloch dient die Figur des Dritten als Spiegel bzw. „déja-vu“ des jeweiligen Ich-Zustands von Bertha und Eckbert. Deshalb kommen diesem Dritten unterschiedliche Rollen zu, die sowohl unterstützend als auch zerstörerisch sein können. Wie die reziproken Verweise in der Namensgebung zeigen (Walther, die Alte, der alte Bauer, Hugo (aus Hund und Vogel)), handelt es sich bei diesem Dritten trotz unterschiedlicher Gestalt und Sichtbarkeit innerhalb der verschiedenen narrativen Ebenen (vgl. Neumann 1997), stets um dieselbe Figur, die an der Schwelle zwischen Realität und Fiktion positioniert ist. Als Chiffre für diese „liminale Schwelle“ fungiert das Kriminalwort „Strohmian“. Nachdem Bertha ihre Erzählung beendet hat, bricht Walther sein Schweigen. Er spricht unvermittelt den Namen des Hundes aus, den Bertha verdrängt hat. Dieser plötzlichen Einbruch des Realen, eine im Sinne der Novellentheorie Goethes „unerhörte Begebenheit“, hat den Tod der Erzählerin und wenig später den Mord am Zuhörer und heimlichen Mitwisser Walther zur Folge. Doch der Dritte kann nicht dauerhaft zum Schweigen gebracht werden. Eckberts Versuch, sich nach dem Tod seiner Frau zu zerstreuen und das Erlebte zu überschreiben, scheitert, weil ihm in Hugo symbolisch Hund und Vogel aus Berthas Geschichte wiederbegegnen. Aus guten Gründen fürchtet er einen erneuten „Strohmian“-Moment in seiner eigene Lebensgeschichte. Die (sexuell konnotierte) panische Flucht, während der er sein Pferd totreitet und sich damit wie Bertha gegen die tierische Natur versündigt, verhindert dies jedoch nicht. Es ist unmöglich, vor der Spiegelgestalt seines Selbst, die das Verdrängte (Inzest, Ehebruch der Vaters) sichtbar macht, zu fliehen. Eckberts suizidaler Wahnsinn liegt in diesem Paradox begründet. Gleichzeitig bildet die zirkuläre Struktur des ständigen Verbergens und Enthüllens, des Vergessens und Ans-Tageslicht-Zerrens den Kern romantischer Poetik. In ihr ist die scharfe Trennung zwischen Realität und Fiktion aufgehoben, weil sie sich der psychischen Dimensionen der Weltwahrnehmung bewusst ist. „Strohmian“, das unterdrückte, immer zirkulierende Zeichen, führt in die Abgründe einer „irrsinnigen Welt“ (Tieck), es zeigt sich als „Streuner“ durch den Text und figuriert als „Strohmann“ für die Wahnvorstellung einer dauerhaften Sinnhaftigkeit im Leben; es bleibt selbstreferentiell und verweist doch auf das literarische Erzählen selbst. „Strohmian“, dieses Rätselwort, kann denn auch als (fast vollständiges) Anagramm des Adjektivs „romantisch“ gelesen werden.
Textausgaben:
Tieck, Ludwig: Der blonde Eckbert / Der Runenberg. Hamburger Leseheft Nr. 228. Hamburg 2011
Tieck, Ludwig: Der blonde Eckbert / Der Runenberg. Textausgabe mit Kommentar und Materialien: Reclam XL – Text und Kontext. Hg. v. Uwe Jansen, Stuttgart 2018
Tieck: „Der blonde Eckbert“: Herunterladen [pdf][228 KB]
Weiter zu Didaktische Hinweise & Vernetzung