Ziel des folgenden Unterrichts
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass für jedes Experiment entsprechend der eigenen Durchführung vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert werden muss. Jede fachkundige Nutzerin/jeder fachkundige Nutzer muss die aufgeführten Inhalte eigenverantwortlich prüfen und an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen.
Weder die Redaktion des Lehrerfortbildungsservers noch die Autorinnen und Autoren der veröffentlichten Experimente übernehmen jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch exakten, veränderten oder fehlerhaften Nachbau und/oder Durchführung der Experimente entstehen. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.gefahrstoffe-schule-bw.de
Ein experimenteller Aufbau zeigt eine Kette an Energieumwandlungen
von der mechanischen Energie über
andere
Energieformen
zurück zur mechanischen Energie.
Didaktische Bemerkungen
Wesentlich bei den folgenden Varianten ist der Anfang der
Kette - der Dynamot. Die Schülerinnen und Schüler
spüren beim Drehen der Kurbel, dass sie eine erhebliche
Kraft
längs eines Weges
- dass sie also mechanische Energie
( E = F
S
⋅s ) - aufbringen müssen. Diese Energie, die
sie in
Handarbeit
in die Anlage einspeisen, läuft über
verschiedene andere Energieformen, die an diesen Stellen
in der Anlage zu beobachten sind (z. B. wenn die Halogenlampe
aufleuchtet; wenn ein Voltmeter die Spannung
an der Solarzelle misst). Und am Ende der Umwandlungskette
sehen sie, wie ein Teil der eingespeisten mechanischen
Energie wieder als mechanische Energie zum Vorschein kommt und der Propeller Wind erzeugt. Das
spürbare
Erleben
- z. B. dass man sich mehr anstrengen muss,
wenn man mehr Energie einspeisen will, damit sich der
Propeller am anderen Ende schneller dreht - ist ein wesentlicher
Aspekt, damit die zunächst nur intuitiv vorliegende
Vorstellung
Energie
und
Energieerhaltung
in
das bestehende Wissen
nachhaltig
eingefügt wird.
Variante Lampe - Solarzelle (A)
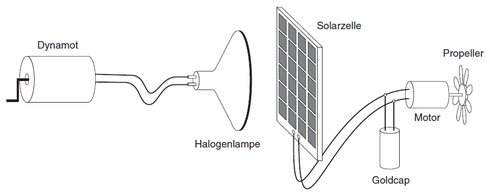
Bei dieser Variante wird an einen Dynamot eine handelsübliche Halogenlampe angeschlossen (20 W - besser 50 W). Das Licht der Halogenlampe fällt auf eine Solarzelle 1 , an deren Anschlüsse ein Elektromotor parallel zu einem Gold-Cap-Kondensator (10 F, 2,3 Vmax) angeschlossen ist.
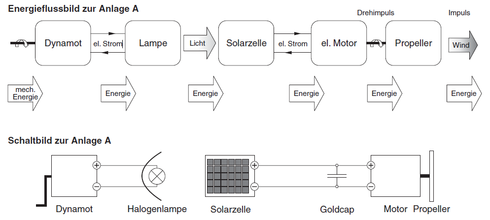
Variante Lampe - Peltiermodul (B)
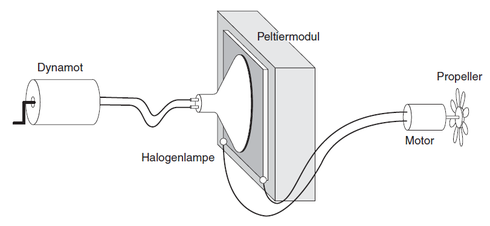
Bei dieser Variante wird an einen Dynamot
ebenfalls eine handelsübliche Halogenlampe angeschlossen
(Wichtig: Hier muss man min. eine 50 W-Halogenlampe
verwenden, das Peltiermodul mit Wärmeleitpaste auf die
Halogenlampe
kleben
und die andere Fläche des Peltiermoduls
mit einem Lüfter oder einem hinreichend
großen Alublock auf Umgebungstemperatur halten! Weiterhin
muss man lange und kräftig genug kurbeln!). Das
Licht der Halogenlampe fällt in dieser Variante auf ein Peltiermodul,
das die elektrische Energie für einen Elektromotor
liefert, der einen Propeller trägt. Auch in dieser Variante
läuft der Propeller nach, obwohl
kein
Gold Cap-
Kondensator als Energiespeicher eingeschaltet ist. Eventuell
fällt auf, dass das Peltiermodul in dieser Variante mit
schwarzer Farbe belegt wird.
Variante Heizspirale - Peltiermodul (C)
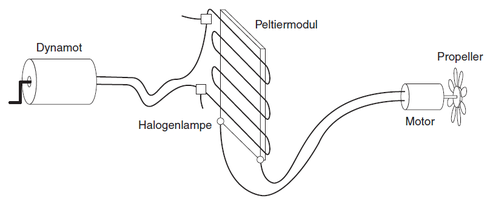
Bei dieser Variante wird an einen Dynamot eine aus Konstantandraht (Länge: 30 cm, Durchmesser 0,5 mm) selbst gebastelte Heizspirale angeschlossen, die mit Klebeband auf dem Peltiermodul befestigt wird. Das Peltiermodul liefert die elektrische Energie an einen Elektromotor, der einen Propeller trägt. Auch in dieser Variante läuft der Propeller nach, obwohl kein Gold-Cap-Kondensator als Energiespeicher eingeschaltet ist.
Variante Dynamot - Heißluftmotor 2 (D)
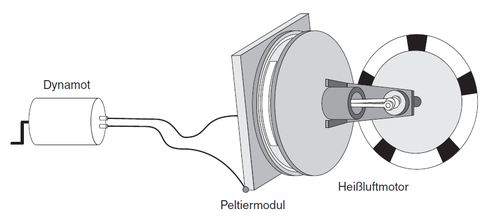
Eine interessante Variante bildet die Energiekette aus einem Dynamot, der ein Peltiermodul (bzw. mehrere Peltiermodule) mit elektrischer Energie versorgt, die wiederum einen Heißluftmotor mit thermischer Energie versorgen.
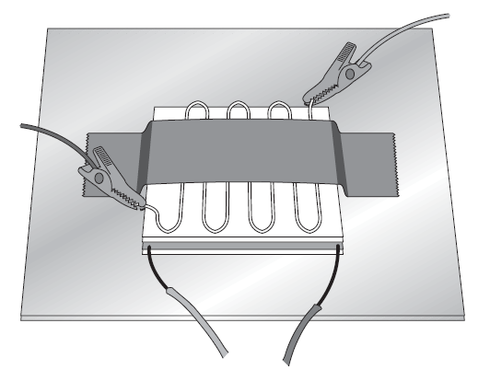
Variante vom Dynamot zum Wasserstoff (E)
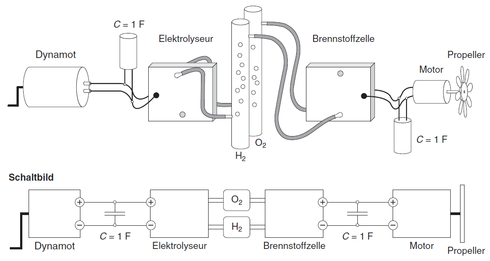
Ein Dynamot ist an einen so genannten Elektrolyseur angeschlossen. Parallel zum Elektrolyseur sitzt ein Goldcap (1 F). Der Elektrolyseur erzeugt Wasserstoffund Sauerstoffgas. Die beiden Schläuche des Elektrolyseurs führen zu einer Brennstoffzelle. Am anderen Ende der Brennstoffzelle ist ein Elektromotor angeschlossen, der einen Propeller antreibt. Parallel zum Elektromotor liegt ein weiterer Goldcap.
Variante von der Solarzelle zum Wasserstoff (F)
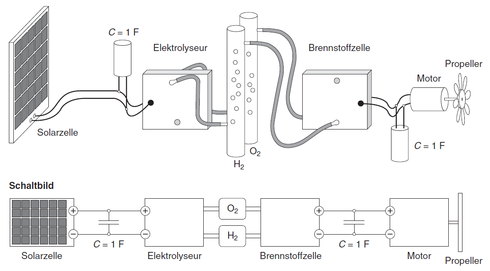
Der Dynamot in der Anlage (E) wird durch eine Solarzelle hinreichender Fläche ersetzt, die am so genannten Elektrolyseur angeschlossen ist. Bei hinreichend intensiver Sonneneinstrahlung funktioniert die Anlage auch in dieser Variante. Parallel zum Elektrolyseur sitzt ein Goldcap (1 F). Der Elektrolyseur erzeugt Wasserstoff- und Sauerstoff-Gas. Die beiden Schläuche des Elektrolyseurs führen zu einer Brennstoffzelle. Am anderen Ende der Brennstoffzelle ist ein Elektromotor angeschlossen, der einen Propeller antreibt. Parallel zum Elektromotor liegt ein weiterer Goldcap. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass man die von uns verwendete Elektrolyseur-Zelle als Brennstoffe-Zelle und umgekehrt einsetzen kann.
-
Elektrolyseur
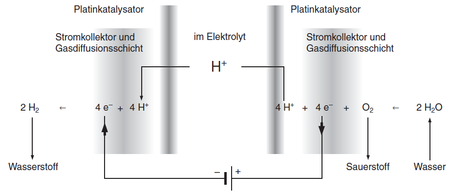
-
Brennstoffzelle
3
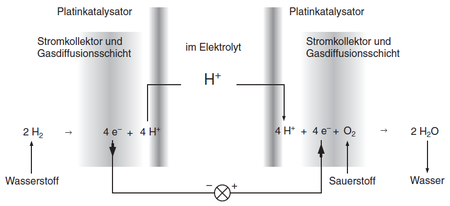
-
Brennstoffzelle und Elektrolyseur in einem Bild
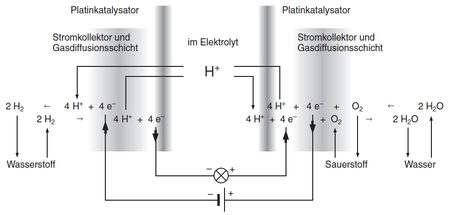
1 Achtung: In diesem Experiment ist ein kleiner Elektromotor eingesetzt, der etwa bei 0,35 V und 14 mA anläuft. Die Solarzelle wird passend zum Motor und zur Beleuchtungsfläche der Halogenlampe gewählt.
2 Unter
http://www.schager-hwm.de/
findet man: Die
SCHAGER Handwärme-Motore
sind Stirlingmotore mit modifizierter Ringbom-Steuerung, die
speziell für den Betrieb auf der Hand entwickelt wurden. Sie können schon eine sehr geringe Temperaturdifferenz, wie sie zwischen der Hand und der
Umgebungsluft üblicherweise vorhanden ist, in mechanische Drehbewegung umsetzen. Ein Temperaturunterschied von 3 K am Verdrängungszylinder
reicht bereits zu einer einwandfreien Funktion aus. Bei ca. 6 K bis 10 K ergibt sich ihr bester Lauf, wobei sie immerhin bis zu 250 bzw. 450 Umdrehungen
pro Minute erzielen.
3
... Im Falle der Wasserstoff-Brennstoffzelle laufen folgende chemische
Reaktionen ab:
gezündet
wird (Knallgasreaktion). In der Brennstoffzelle
wird diese Reaktion gebändigt, sie läuft kontrolliert und bei Raumtemperatur
ab. Wasserstoff reagiert hier nicht direkt mit dem
Luftsauerstoff, sondern gibt seine Elektronen an der Platinanode ab, die
als Katalysator wirkt. Die zurückbleibende H
+
-Ionen diffundieren durch
die Polymermembran (sie ist nur durchlässig für H
+
-Ionen, also semipermeabel).
Die im äußeren Stromkreis zur Kathode fließenden Leitungselektronen
neutralisieren die H
+
-Ionen zu H-Radikalen (wiederum über
Vermittlung der Katalysatorwirkung des Platins), die mit dem Luftsauerstoff
zu H
2
O reagieren, welches abgeführt wird. Die Betriebsspannung einer
einfachen Zelle liegt bei 0,3 bis 0,9Volt ...
... mit anderen Worten: An der linken und rechten Elektrode werden
Wasserstoff- (H
2
) und Sauerstoffmoleküle (O
2
) mit Hilfe des Katalysators
jeweils in
Einzelatome
zerlegt. Wasserstoffatome geben Elektronen an
die rechte metallische Elektrode ab, während das Proton durch den Elektrolyten
(
Protonenventil
- lässt nur Protonen durch!) zur rechten Elektrode
wandern kann ... an der rechten Elektrode entsteht aus Protonen,
Elektronen und Sauerstoffatomen ein Wassermolekül.
aus H. Krenn: Die Physik von Kontakten, PdN-PhiS. 3/54. Jg. 2005.
Unterrichtseinheit Energieumwandlungsketten: Herunterladen [pdf] [129 KB]
Weiter mit Unterricht
