Das Kommunikationsmodell der Sophisten
Infobox
Diese Seite ist Teil einer Materialiensammlung zum Bildungsplan 2004: Grundlagen der Kompetenzorientierung. Bitte beachten Sie, dass der Bildungsplan fortgeschrieben wurde.
1. a) Parallelen Sophistik - „Jugend debattiert“
Pro-Kontra-Position: Prinzip, dass es zu jeder Aussage eine entgegengesetzte gibt und dass man die schwächere Aussage zur stärkeren machen kann
b) Nicht berücksichtigt sind Elemente, die das Agonale sehr betonen und stark auf Affekterzeugung als Mittel setzen, den Sieg davonzutragen. Diese Mittel führen dazu, dass keine sachliche Debatte mehr möglich ist.
2. Wichtig sind Hinweise, dass in einer offenen Gesellschaft über viele Fragen Verständigung erzielt werden muss und dass an diesem Prozess prinzipiell alle Bürger beteiligt sein können. Nur so können die einzelnen ihre Rechte als Staatsbürger wahrnehmen - und nur so können die möglichst besten Entscheidungen getroffen werden. In der Politik geht es darum, dass unterschiedliche Interessen sich Gehör verschaffen können. Das setzt ein ausgeprägtes kommunikatives Können und eine Kultur der Auseinandersetzung voraus.
Alternativfrage
s. Aufgabe 2.
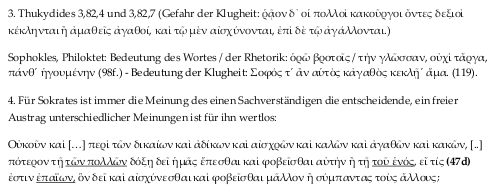
5. Beide Thesen sind plausibel. Deshalb versucht unsere Gesellschaft eine Balance zwischen den Vor- und Nachteilen des Agons zu finden. So versucht das Wirtschaftssystem etwa die Vorteile zu fördern, das Sozialsystem die Nachteile auszugleichen.
6. In allen diesen Bereichen stoßen unterschiedliche Interesse aufeinander, und eine Lösung muss gefunden werden. Die Pro- und Kontra-Rhetorik der Sophisten findet sich deshalb hier wieder. Die Leistungsfähigkeit dieses Modells beruht darauf, dass sich prinzipiell alle an der Entscheidung beteiligen können, dass der Entscheidungsprozess offen ist und nicht Autoritäten, sondern Argumente den Ausschlag geben. Gefahren drohen, wenn die Debatten unsachlich geführt werden oder wenn berechtigte Interessen unzureichend artikuliert werden.
Additum
Parallelen zwischen Nietzsche und den Sophisten:
- Es gibt keine verbindlich feststehende Wahrheit.
- die Empfindungen sind subjektiv und sind als solche auch berechtigt.
- Die Wörter und ihre Bedeutung sind aus den subjektiven Empfindungen hervorgegangen, d.h. sie bezeichnen keine objektive Wahrheit, sondern sind willkürliche Festlegungen.
Aus allem ergibt sich als Folgerung, dass die Ebene der Subjektivität nur durch Rhetorik verlassen werden kann, um zu allgemein geteilten Aussagen zu gelangen.
Unterrichtsmodelle zur Förderungen der personalen Kompetenzen bei der Interpretationsarbeit: Herunterladen [doc][623 KB]
weiter mit Gemeinsame Wahrheitsfindung im „Kriton“?
