Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft
Naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn
Was sind Naturwissenschaften?
- Die Naturwissenschaften befassen sich mit der systematischen Erforschung der Natur und dem Auffinden von Gesetzmäßigkeiten, mit deren Hilfe (natürliche) Phänomene erklärt werden können. Ein weiteres Ziel ist, – neben dem Versuch, die Natur besser zu verstehen – das gewonnene theoretische Wissen zu nutzen, um damit praktische Probleme zu lösen und durch technische Innovation unser Leben auf dieser Welt zu verbessern.
- Die folgende Abbildung zeigt zunächst diejenigen methodischen Schritte, die ein Wissenschaftler macht, wenn er zu einem theoretischen Verständnis eines Naturphänomens kommen will: Schritte (1) und (2).
- Darüber hinaus verdeutlicht sie, was zu tun ist, wenn das theoretische Wissen in der Praxis (also außerhalb des Labors) Anwendung finden soll: Schritte (3) und (4).
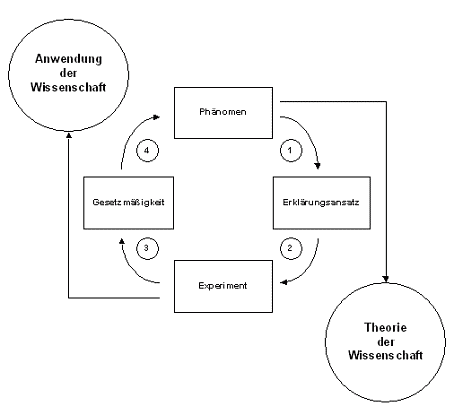
Naturwissenschaftliche Methodik
Am Anfang steht das Phänomen
Erläuterungen zur Abbildung:
- Phänomen beobachten, beschreiben und Vermutungen anstellen, wie dieses Phänomen zu erklären sein könnte
- Sobald ein plausibler, Erfolg versprechender Erklärungsansatz gefunden ist, wird ein Experiment entworfen, um den Erklärungsansatz zu testen.
- Hat das Experiment (vielleicht auch erst nach vielen missglückten Versuchen und Irrtümern) schließlich gezeigt, dass der Erklärungsansatz richtig ist, kommt der Wissenschaftler zu einer Aussage, d. h. er formuliert eine Gesetzmäßigkeit, eine Formel o.ä.
- Diese Gesetzmäßigkeit ermöglicht es, Phänomene richtig vorherzusagen und dient dann in der Anwendung der Wissenschaft einer Nutzbarmachung der gewonnenen Einsicht in Form von Produktgestaltung und Innovation.
Ein Beispiel aus dem Alltag:
| Schritt 1 | Nehmen wir an, Sie haben in den letzten paar Nächten schlecht geschlafen. Normalerweise sind Sie ein guter Schläfer, insofern ist das etwas Ungewöhnliches. Was könnten Gründe für die Schlafstörungen sein? Die Klausuren nächste Woche? Nein, die gab´s ja schon vorher und da haben Sie auch immer gut geschlafen. Die letzten Wochen waren sehr heiß und schwül, Sie haben große Mengen an Eistee, Ihrem Lieblingsgetränk, getrunken. Es könnte also sehr gut möglich sein, dass das darin enthaltene Koffein Ihren Schlaf gestört hat. Ist das die richtige Erklärung? |
| Schritt 2 | Ein relativ schneller und einfacher Test – ein Experiment – wird eine Antwort geben. Sie trinken an den nächsten Abenden anstatt des Eistees Eis wasser . |
| Schritt 3 | Falls Sie wieder normal schlafen, können Sie davon ausgehen,
dass Ihre Erklärung richtig war. Sie kommen zu der Feststellung, dass Koffein Ihren Schlaf behindert. |
| Schritt 4 | Wenn nicht schon längst geschehen, könnte jemand auf die Idee kommen, diese Einsicht / Gesetzmäßigkeit zu nutzen, indem er „Wachmacher-Getränke“ oder Tabletten auf Koffeinbasis herstellt, vertreibt und damit steinreich wird. |
Ein Beispiel aus der Physik:
| Schritt 1 | Die Anfänge der Elektrizität gehen auf das Phänomen der Influenzerscheinungen sowie Versuche von Guericke 1672 zurück. Am Anfang des Erkenntnisgewinns steht hier als Erklärungsansatz die Hypothese von der Existenz eines elektrischen Fluidums . |
| Schritt 2 | Diese Hypothese reichte zusammen mit dem Ladung sbegriff aus, um experimentell als erste Gesetzmäßigkeit das coulombsche Gesetz zu finden. |
| Schritt 3 | In den folgenden Jahrzehnten wurden weitere Experimente geplant
und durchgeführt, die zu jeweils neuen Phänomenen wiederum ihre eigenen
Hypothesen in sich trugen. Die Voltasäule und das amperesche Gesetz wurden
ermittelt. Beide Gesetzmäßigkeiten waren zusammen mit dem magnetischen Feldbegriff
die Voraussetzungen für das faradaysche Induktionsgesetz. Die maxwellsche
Hypothese, nach der sich Licht und Elektromagnetismus in einer Theorie darstellen
lassen, erstaunte die Zeitgenossen. Die maxwellschen Gleichungen sind bis
heute gültig und beschreiben die gesamte Elektrodynamik. Erst nach 1864 wurde die Existenz der Elektronen als Teilchen nachgewiesen. Mit der speziellen Relativitätstheorie und den Atommodellen fand die klassische Physik zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Die Teilchenvorstellung führte jedoch in Experimenten zu Widersprüchen. In die modernen physikalischen Theorien ging der Dualismus von Teilchen und Welle für Elektronen ein. |
| Schritt 4 |
Erst nach Jahrzehnten technischer Entwicklung können anwenderorientierte
Produkte wie Laser, Brennstoffzelle, Handy oder Rastertunnelmikroskop gekauft
werden. Teilweise gehen diese Geräte auf die Nutzbarmachung jahrhundertealter
Einsichten zurück. Das Beispiel aus der Physik steuerte Heller, Karl, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Nürtingen bei. |
Zur Vertiefung:
Übungen
Hier ein paar Übungsbeispiele für Lehrerinnen und Lehrer, die helfen sollen, im Unterricht zumindest den wissenschaftstheoretischen Teil zu vertiefen. Vielleicht gehen Sie auch noch einen Schritt weiter und überlegen mit der Klasse, wie die theoretischen Einsichten in der Praxis angewendet werden könnten – möglicherweise machen Sie dabei eine geniale Erfindung, werden Millionär und müssen nie mehr unterrichten...!
Aufgabenstellung: Wenden Sie die Schritte aus der obigen Abbildung auf folgende Phänomene an:
- Eines der kleinen Ärgernisse im Leben sind verdrillte Telefonschnüre. Egal wie vorsichtig man ist, nach ein paar Wochen ist das Kabel immer hoffnungslos in sich verdreht.
- Studien zeigen, dass in Frankreich und anderen Mittelmeerländern Herz-Kreislauf-Erkrankungen weit seltener sind als in Amerika.
- Auffallend viele Patienten einer Zahnklinik klagen in den Monaten nach der Behandlung ihrer kariösen Zähne über Kopfweh und Schlafstörungen.
- Reißt man aus einer Zeitung einen Artikel oder ein Bild aus, so stellt man fest, dass in der Vertikalen der Riss (mehr oder weniger) geradlinig verläuft. In der horizontalen Richtung dagegen ist dies – sehr zu unserem Ärger – nicht zu schaffen.
- Alle Körper fallen fast gleich schnell ...
Die obigen Ausführungen geben in stark gekürzter Form die
ersten drei Kapitel des Buches "A Beginner´s Guide to
Scientific Method" von Carey, S. Stephen wieder. Dort werden in großem Umfang
Übungsbeispiele genannt; allerdings sind sehr gute Englischkenntnisse nötig,
um diesen Leitfaden – der für amerikanische Studenten im Grundstudium geschrieben
wurde – lesen und verstehen zu können.
Übersetzung und Textauswahl verdanken wir Schwerdtfeger, Axel, Carl-Engler-Schule,
Karlsruhe.
Geisteswissenschaftliche Erkenntniswege
Was sind Geisteswissenschaften?
- Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, die versuchen, natürliche Phänomene zu erklären, um daraus für die Praxis verwertbare Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, haben die Geisteswissenschaften sich weit komplexere, mit der naturwissenschaftlichen Formelsprache unlösbare und in Hinblick auf eine wirtschaftliche Verwertbarkeit oft nutzlos erscheinende Aufgaben gestellt.
- Sie betrachten all diejenigen Phänomene, die sich aus dem Wirken des Menschen als geistvoll (oder geistlos!) handelndes Wesen ergeben. Egal, ob in der Geschichte, in der Gesellschaft oder in der Literatur – die Geisteswissenschaften haben die Aufgabe, die Erscheinungsformen menschlichen Handelns zu beschreiben, in ihrer Bedeutung für Individuum und Gesellschaft zu werten und dienen so der Schaffung menschlichen Bewusstseins.
Die folgende Abbildung soll – im direkten Vergleich mit der Methodik der Naturwissenschaften – die Arbeitsweisen, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Geisteswissenschaften aufzeigen:
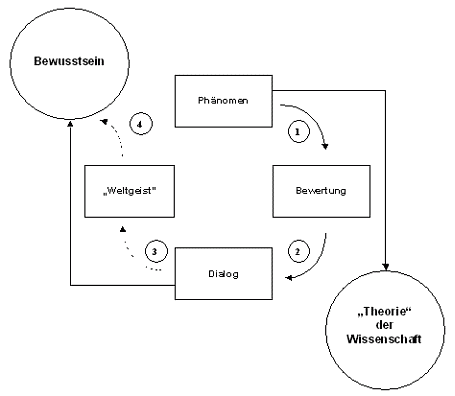
Geisteswissenschaftliche Methodik
Am Ende (nur?!) Bewusstsein
Zur Erklärung auch hier ein Beispiel :
| Schritt 1 | Die Dramen von William Shakespeare beschäftigen Literaturwissenschaftler noch heute. Nicht etwa, weil man es bisher nicht geschafft hätte, die Rätsel zu lösen, für die es sicher Gesetzmäßigkeiten bzw. Lösungen gibt. Die Wissenschaftler sind darauf aus, immer neue Aspekte in seinem literarischen Werk zu entdecken, um damit die Bedeutung Shakespeares für seine Zeitgenossen und für die Nachwelt zu erfassen. |
| Schritt 2 | Um nun zu „testen“, ob er mit seiner Deutung der
Shakespearedramen richtig liegt, tritt der Wissenschaftler in einen Dialog
mit anderen Wissenschaftlern. Dieser Dialog ist eine „Sammlung subjektiver
Einschätzungen“ und Ersatz für einen Test, der objektiv die Richtigkeit
der eigenen Thesen beweisen könnte, den es aber nicht gibt. Hier macht sich bei den Beteiligten möglicherweise Frustration breit, denn Richtiges und Falsches lassen sich nicht immer sauber trennen und so wird den Geisteswissenschaften gerne Beliebigkeit vorgeworfen. |
| Schritt 3 | Spätestens bei diesem Schritt geraten Natur- und Geisteswissenschaften aus ihrem bisherigen Gleichschritt. Der Geisteswissenschaftler stolpert und der Naturwissenschaftler schaut sich mitleidig um. Während er jetzt daran gehen kann, seine theoretischen Einsichten in technische Innovation (und möglicherweise bare Münze) umzusetzen, bleibt dem Geisteswissenschaftler nur die traurige Gewissheit, dass er sein diffuses und in unendlicher Ferne liegendes Ziel eines wie auch immer gearteten „Weltgeistes“, einer „ultimativen Gesetzmäßigkeit für menschliches Handeln“ niemals wird erreichen können. Vielleicht hat er dieses Ziel auch nie gehabt... |
| Schritt 4 |
So richtet sich sein Augenmerk nicht auf die Reproduzierbarkeit der Phänomene ( ein Shakespeare reicht doch und Kopien sind immer schlecht!), sondern darauf, dass er als Mensch die Fülle der Einzelerscheinungen, die ihm das Leben bietet, wahrnimmt und als bereichernd, als bildend, in letzter Konsequenz als sinngebend erkennt. Ziel der Naturwissenschaften ist die Daseinsbewältigung. Ziel der Geisteswissenschaften ist es, für dieses Dasein ein Bewusstsein zu schaffen. |
Zur Vertiefung:
Übungen
- Wie lassen sich die Psychologie und die Wirtschaftswissenschaften
in das Schema Naturwissenschaft – Geisteswissenschaft einordnen?
Ist menschliches Handeln vorhersehbar?
Wenn ja, wer hätte ein Interesse, die Gesetzmäßigkeiten zu kennen? - Könnten sich Historiker nicht um mehr „Naturwissenschaftlichkeit“ bemühen, damit Gesetzmäßigkeiten gefunden werden, mit deren Hilfe Kriege verhindert werden könnten?
- Warum müssen alle Phänomene, alle Erscheinungsform in unserer Welt immer sofort erklärt werden? Reicht es nicht, sie einfach zu bestaunen?
Diese Ausführungen verdanken wir
Schwerdtfeger, Axel, Carl-Engler-Schule, Karlsruhe.
