Bibliographieren
| Ein Literaturverzeichnis zu einem Thema erstellen, das bedeutet bibliographieren. |
Es dient einerseits dazu, das Werk eines Autors zweifelsfrei identifizieren zu können, und ist eine Hilfestellung für den Leser. Andererseits kennzeichnet es eindeutig die direkte oder indirekte Übernahme geistigen Eigentums. Beides ist für wissenschaftlich exaktes und ethisch korrektes Arbeiten ein grundlegendes Prinzip.
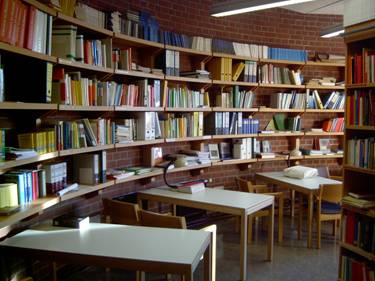
Abbildung 1: Bibliothek (Fegert 2005). Genaues Bibliographieren erspart hinterher
das Suchen.
Das Literaturverzeichnis erfasst in alphabetischer Reihenfolge systematisch alle Quellen, die im fortlaufenden Text verwendet und damit zitiert werden. Das Zitat in der Fußnote oder noch praktikabler das Zitat nach dem „Harvard-System“ im fortlaufenden Text findet seine Differenzierung im Literaturverzeichnis.
| Damit wird deutlich, dass es eine kausale Verbindung zwischen dem Zitieren und Bibliographieren gibt. |
Vergleichen Sie dazu auch die Links
Zitieren
und Harvard-System
sowie
Zitieren in der Fußnote
.
Diese
Daten
brauchen die
Schüler beim Zitieren.
Grundlegend unterscheidet man
- Primärliteratur und
- Sekundärliteratur.
| Primärliteratur ist die Original-Quelle, mit der man arbeitet. Sekundärliteratur sind Aussagen (von Experten) über die Original-Quelle. |
Die Gliederungsstruktur für eine Bibliographie könnte sein:
- Archivalien (= amtliche Akten, Protokolle etc.)
- Mündliche und briefliche Quellen
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Internet-Quellen
- Audio-Quellen
- Film
- Statistik
- Landkarten.
Zur Quellenangabe des Werkes gehören prinzipiell folgende Essentials, auch bibliographische Daten genannt:
|
Der Name des Autors wird zur Hervorhebung in Kapitälchen (Großbuchstaben in der Größe von Kleinbuchstaben) gesetzt. Diese Darstellung ist aber auf unseren Internetseiten nicht möglich. Erscheint ein Werk in einer weiteren als der ersten Auflage, so setzt man diese Angabe als Hochzahl vor das Erscheinungsjahr.
Die benutzte Literatur wird nach dem Nachnamen der Autoren sortiert. Werden mehrere Werke des gleichen Autors benutzt, nimmt man zusätzlich eine chronologische Ordnung vor. Gibt es von einem Autor mehrere Werke mit gleichem Erscheinungsjahr, fügt man hinter dem Erscheinungsjahr die Buchstaben „a“, „b“ etc. hinzu.
Beispiel:
Bornemann, Monika und Michael u. a. (2003): Referate Vorträge Facharbeiten.
Von der cleveren Vorbereitung zur wirkungsvollen Präsentation. Mannheim.
Die geschickteste Informationsquelle ist das Titelblatt eines Buchs (nicht das Cover!) oder eines Aufsatzes sowie die Rückseite des Titelblatts. Letztere enthält heutzutage meist den Wortlaut der CIP-Einheitsaufnahme der Deutschen Bibliothek, die alle wichtigen bibliographischen Daten erfasst hat. Diese kann man direkt übernehmen.
Der Nachweis von Abbildungsquellen erfolgt am besten direkt im Anschluss an die Bildbeschriftung. Sinnvoll ist es, eine kurze Bildinterpretation als Hilfestellung für den Betrachter hinzu zu fügen.

Abbildung 2: Methodentraining (Fegert 2005). Schülerinnen und Schüler
lernen, Mindmaps zu erstellen.
Dieser Quellennachweis erscheint dann identisch im Abbildungsverzeichnis, allerdings ohne die Bildinterpretation, siehe dazu folgendes Beispiel:
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Bibliothek (Fegert 2005)
Abbildung 2: Methodentraining (Fegert 2005).
Verfasser dieses Beitrags: Fegert, Friedemann, Carl-Engler-Schule, Karlsruhe
