Kurzfassung Umfrage
Wenn Parteien oder Politiker erfahren wollen, wie ihre Vorschläge bei den Wählern
ankommen, lassen sie Umfragen durchführen. Da die Sozialforscher unmöglich alle
Wähler befragen können, wählen sie eine bestimmte Personengruppe (in der Regel
2000 Personen) nach vorher bestimmten Kriterien (z. B. Geschlecht, Alter, Zugehörigkeit
zu Berufsgruppen, ländliche Bezirke, Ballungsräume usw.) aus und fragen nach
deren Meinung. Diese Gruppe steht stellvertretend für die gesamte wahlberechtigte
Bevölkerung. Man nennt so eine Umfrage deshalb „repräsentativ“.
Dieselbe Methode wird auch von Wirtschaftsunternehmen angewandt, um Marktforschung zu betreiben (z. B. um die Absatzmöglichkeiten neuer Produkte zu testen).
| Vorbereitung |
Ziel klären
- Zunächst muss geklärt werden, was man mit einer Umfrage eigentlich heraus bekommen will (z. B. „Werden Jungen und Mädchen in Familie und Schule unterschiedlich erzogen?“).
- In einem zweiten Schritt muss die Zielgruppe der Umfrage festgelegt werden (z. B. Mitschüler, 15 - 20-jährige usw.)
- In einem dritten Schritt muss man sich entscheiden, ob man eine mündliche oder schriftliche Umfrage machen will. Im ersten Fall muss man sich überlegen, wie man die Befragung beginnt (sich vorstellen, den Befragten motivieren). Im zweiten Fall muss ein Fragebogen entworfen werden.
Vermutungen (Hypothesen) aufstellen
Da eine Umfrage ein bestimmtes Ziel verfolgt, erwartet man auch bestimmte Antworten. (So kann man z. B. vermuten, dass in manchen Familien in der Kindererziehung bestimmte Geschlechterrollen übernommen werden, ohne sie zu hinterfragen. Vielleicht müssen Mädchen öfters in der Küche helfen als ihre Brüder, oder es könnte sich in der Auswahl der Geschenke, z. B. Spielsachen, zeigen, dass diese auf eine spätere geschlechtsspezifische Rolle als Erwachsene vorbereiten sollen.)
Voruntersuchung bzw. Test durchführen
Bevor die eigentliche Befragung beginnt, sollte durch Vorinterviews mit Freunden und Bekannten „getestet“ werden. Auf diese Weise kann man erkennen, ob die Fragen richtig formuliert sind und verstanden werden. Aus den Antworten kann ersehen werden, ob die gesetzten Ziele der Befragung erreicht werden können. Fragen so zu stellen, dass der Befragte nicht manipuliert oder abgeschreckt wird, muss gelernt und geübt werden. Dabei hilft ein Rollenspiel und die Beachtung von Regeln für Fragebögen und das Vermeiden von kritischen Fragestellungen.
| Durchführung |
Fragebogen ausfüllen
Beispiel für eine Meinungsumfrage nach: Ackermann, Paul; Gassmann, Reinhard (1991): Arbeitstechniken politischen Lernens, Stuttgart, S. 39.
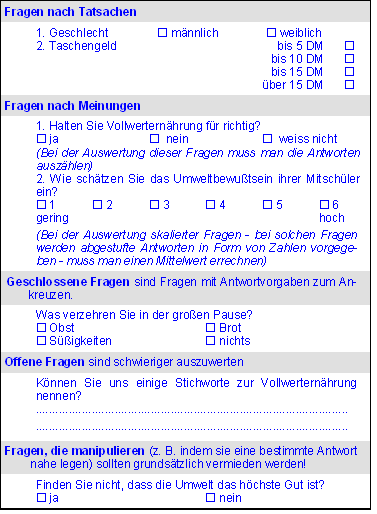
Eine Checkliste für Fragebogen finden Sie hier.
| Auswertung und Interpretation |
Auf Grund der Häufigkeit von Antworten können nun Rückschlüsse gezogen werden, z. B.:
War die Anfangsvermutung richtig (z. B. dass man sowohl in der Schule als auch in der Familie noch häufig auf geschlechterspezifische Rollenverteilung trifft)? Wie ließe sich an dieser Situation, die wohl kaum wünschenswert ist, etwas ändern? Welche (z. B. politische) Forderungen können (oder müssen) aus der Befragung abgeleitet werden?
Oder: Müssen wir unsere Eingangshypothese korrigieren auf Grund eines unerwarteten Umfrageergebnisses?
Text nach: Weinbrenner, Peter (Hrsg.) (1996): Anstöße 3. Ein Arbeitsbuch für den Politikunterricht. Stuttgart, S. 30ff.
